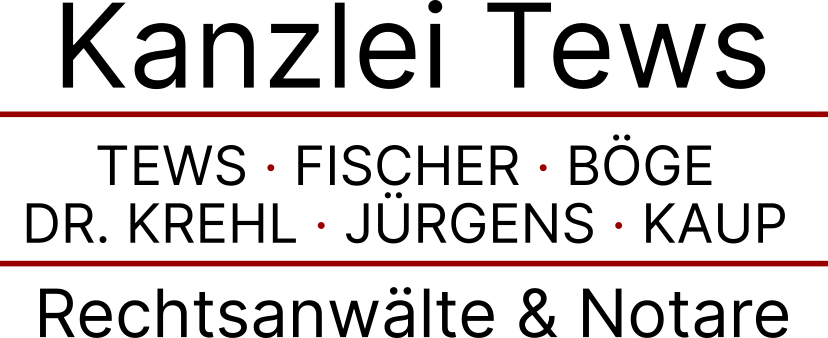Januar 2023
- Januar 2023
- Arbeitsrecht
- Vorerkrankungen: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung genügt nicht immer für die Entgeltfortzahlung
- Kündigungsschutzklage: Private Nutzung eines Firmenwagens: Keine Kündigung ohne Abmahnung
- BFH-Entscheidung: Fahrzeugwerbung: Entgelt ist oft Arbeitslohn
- Youtube-Video: Meinungsfreiheit überstrapaziert: Lehrer erhält fristlose Kündigung
- Baurecht
- Familien- und Erbrecht
- Mietrecht und WEG
- Verbraucherrecht
- Verkehrsrecht
- Betriebsgefahr: Rettungswagen im Einsatz: Bei Unfall Schmerzensgeld möglich
- Nutzungsausfallentschädigung: Porsche-Fahrer muss mit Ford Mondeo zurechtkommen
- Schadensminderungspflicht: Fünf-Tage-Reparatur am fahrfähigen Fahrzeug
- Hilfsbereitschaft: Gerissenes Abschleppseil: Wer gezogen wird, haftet
- Schadenersatz: Mietwagenkosten und Verzögerung: Wer trägt das Risiko?
- Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
- Arbeitsrecht
Arbeitsrecht
Vorerkrankungen: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung genügt nicht immer für die Entgeltfortzahlung
Ist der Arbeitnehmer länger als sechs Wochen arbeitsunfähig, reicht die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) nicht aus, um automatisch eine Entgeltfortzahlung zu bekommen. Es darf keine Fortsetzungserkrankung vorliegen, was der Arbeitnehmer beweisen muss. Das entschied das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen.
Das war geschehen
Der Kläger war in den Kalenderjahren 2019 und 2020 im erheblichen Umfang arbeitsunfähig erkrankt. Im Zeitraum August bis Dezember 2019 war er an 68 Kalendertagen und im Zeitraum Januar bis August 2020 an 42 Kalendertagen erkrankt. Am 18. August 2020 legte der Kläger eine weitere Erstbescheinigung vor und verlangte eine entsprechende Entgeltfortzahlung. Der beklagte Arbeitgeber hatte jedoch Zweifel, dass eine neue Erkrankung vorlag und verweigerte daher die Entgeltfortzahlung. Dagegen wandte der Kläger ein, er habe für den streitgegenständlichen Zeitraum Erstbescheinigungen vorgelegt, woraus zu ersehen sei, dass Vorerkrankungen nicht vorgelegen hätten. Aus Datenschutzgründen sei er zudem nicht verpflichtet, sämtliche Diagnosen offenzulegen.
Entgeltfortzahlung nur bei „neuer“ Erkrankung
Das Gericht wies die Klage ab und begründete seine Entscheidung damit, dass die AU keine Angaben zum Bestehen einer Fortsetzungserkrankung enthält. Hintergrund ist, dass die Entgeltfortzahlung entfällt, wenn die Krankheit länger als sechs Wochen andauert. Der Arbeitnehmer hat dagegen weiterhin Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn die erneute Arbeitsunfähigkeit auf einer anderen Erkrankung beruht.
Aus der Entscheidung folgen diese Grundsätze für die Praxis: Zunächst muss der Arbeitnehmer darlegen, dass keine Fortsetzungserkrankung vorliegt. Hierzu kann er eine ärztliche Bescheinigung vorlegen.
Arbeitnehmer muss beweisen
Bestreitet der Arbeitgeber das Vorliegen einer neuen Krankheit, muss der Arbeitnehmer die Tatsachen darlegen, die den Schluss erlauben, es habe keine Fortsetzungserkrankung vorgelegen. Um dieser abgestuften Darlegungslast gerecht zu werden, muss der Arbeitnehmer grundsätzlich zu allen Krankheiten im Jahreszeitraum substanziiert vortragen. Er kann nicht eine „Vorauswahl“ treffen und nur zu denjenigen Erkrankungen vortragen, die ihm als möglicherweise einschlägig erscheinen.
Datenschutz: Gesundheitsdaten dürfen unter bestimmten Voraussetzungen verarbeitet werden
Diese Pflicht berührt zwar das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Arbeitnehmers. Sie ist aber nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gerechtfertigt. Dort wird die Verarbeitung von Gesundheitsdaten gestattet, wenn sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder bei Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich ist.
Quelle | LAG Hessen, Urteil vom 14.2.2022, 10 Sa 898/21
Kündigungsschutzklage: Private Nutzung eines Firmenwagens: Keine Kündigung ohne Abmahnung
Vor Ausspruch einer Kündigung ist es oft erforderlich, zunächst eine Abmahnung auszusprechen. Diese geht – in vielen Fällen – der Kündigung als mildestes Mittel vor. Hierauf hat aktuell noch einmal das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpommern hingewiesen.
Der Arbeitgeber hatte in der Vergangenheit die kurzzeitige Nutzung von Firmenfahrzeugen zu privaten Zwecken nach Rücksprache mit dem Vorgesetzten gestattet. Ein Arbeitnehmer hatte dann das Fahrzeug ohne Erlaubnis genutzt, da er in diesem Moment nicht die Möglichkeit hatte, Kontakt zu seinem Vorgesetzten aufzunehmen.
Der Arbeitgeber hatte das zum Anlass genommen, dem Arbeitnehmer zu kündigen. Dessen Kündigungsschutzklage hatte vor dem LAG Erfolg. Es machte deutlich, dass die Pflichtverletzung hier nicht so groß sei, dass sie eine umgehende Kündigung rechtfertigen würde. Es sei in diesem Fall vielmehr erforderlich gewesen, vor Ausspruch der Kündigung die Pflichtverletzung abzumahnen.
Quelle | LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 21.6.2022, 5 Sa 245/21
BFH-Entscheidung: Fahrzeugwerbung: Entgelt ist oft Arbeitslohn
Nach Meinung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist ein von einem Arbeitgeber an seine Arbeitnehmer gezahltes Entgelt für Werbung des Arbeitgebers auf dem Kennzeichenhalter des privaten Pkw des Arbeitnehmers Arbeitslohn, wenn dem abgeschlossenen „Werbemietvertrag“ kein eigenständiger wirtschaftlicher Gehalt zukommt.
Nicht jede Zahlung eines Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer stellt Arbeitslohn dar. Vielmehr kann ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer neben dem Arbeitsvertrag weitere eigenständige Verträge abschließen. Kommt einem gesondert abgeschlossenen Vertrag allerdings kein eigenständiger wirtschaftlicher Gehalt zu, kann es sich insoweit um eine weitere Arbeitslohnzahlung handeln.
Ein Arbeitgeber hatte mit einem Teil seiner Arbeitnehmer „Werbemietverträge“ geschlossen. Danach verpflichteten sich diese, mit Werbung des Arbeitgebers versehene Kennzeichenhalter an ihren privaten Pkw anzubringen. Dafür erhielten sie jährlich 255 Euro. Der Arbeitgeber behandelte das „Werbeentgelt“ als sonstige Einkünfte gemäß Einkommensteuergesetz (§ 22 Nr. 3 EStG) und behielt daher keine Lohnsteuer ein. Dies war auch für die Arbeitnehmer vorteilhaft, da solche Einkünfte unterhalb eines Betrags von 256 Euro jährlich steuerfrei sind. Das Finanzamt ging aber von einer Lohnzahlung aus und nahm den Arbeitgeber für nicht einbehaltene und abgeführte Lohnsteuer in Haftung – und zwar zu Recht, wie das FG Münster und der BFH entschieden. Die Zahlungen gehören zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit, weil sie durch das Arbeitsverhältnis veranlasst sind und nicht auf einem Sonderrechtsverhältnis „Mietvertrag Werbefläche“ beruhen, da diesem kein eigener wirtschaftlicher Gehalt zukommt.
Der BFH erachtete insbesondere die folgenden Würdigungen der Vorinstanz nicht nur als möglich, sondern als naheliegend: Dem gesondert abgeschlossenen „Mietvertrag Werbefläche“ kam unter Berücksichtigung der am Markt befindlichen Angebote schon aufgrund seiner Ausgestaltung kein eigener wirtschaftlicher Gehalt zu. Denn die Erzielung einer Werbewirkung war nicht sichergestellt und die Bemessung des Entgelts war offensichtlich an der im Einkommensteuergesetz geregelten Freigrenze orientiert. Der Werbeeffekt war nicht – wie im wirtschaftlichen Geschäftsverkehr üblich – ausschlaggebendes Kriterium für die Bemessung des Entgelts gewesen. Das FG berücksichtigte, dass Verträge ausschließlich mit Mitarbeitern geschlossen wurden und die Laufzeit der Verträge an das Bestehen des Arbeitsverhältnisses geknüpft war.
Quelle | BFH, Beschluss vom 21.6.2022, VI R 20/20
Youtube-Video: Meinungsfreiheit überstrapaziert: Lehrer erhält fristlose Kündigung
Das Arbeitsgericht (ArbG) Berlin hat die fristlose Kündigung eines Lehrers des Landes Berlin als wirksam erachtet, der auf YouTube ein Video veröffentlicht hat, das eine Darstellung des Tores eines Konzentrationslagers mit der Inschrift „IMPFUNG MACHT FREI“ enthielt.
Das war geschehen
Der Lehrer hat ein YouTube-Video unter dem Titel „Sie machen Tempo! Und Ich denke…“ veröffentlicht. Am Anfang des Videos wird für etwa drei Sekunden ein Bild eingeblendet, auf dem das Tor eines Konzentrationslagers abgebildet ist. Der Originalschriftzug des Tores „ARBEIT MACHT FREI“ wurde durch den Text „IMPFUNG MACHT FREI“ ersetzt. Es folgt dann eine ebenfalls etwa drei Sekunden lange Einblendung eines Tweets des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der eine Ausweitung der Impfangebote ankündigt und in dem er die Aussage „Impfen ist der Weg zur Freiheit“ trifft. Die Einblendungen zu Beginn des Videos werden weder durch Text noch durch mündliche Erklärungen näher erläutert. Abrufbar war das Video unter einem Standbild der ersten Einblendung des Videos.
Das Land Berlin hat den Lehrer u. a. wegen der Veröffentlichung dieses Videos fristlos, hilfsweise fristgemäß gekündigt. Der Lehrer setze in dem Video das staatliche Werben um eine Impfbereitschaft in der Pandemie mit der Unrechtsherrschaft und dem System der Konzentrationslager gleich. Damit verharmlose er die Unrechtstaten der Nationalsozialisten und missachte die Opfer. Der Lehrer habe seine Schüler aufgefordert, seinen außerdienstlichen Aktivitäten im Internet zu folgen und sich in anderen Videos auch als Lehrer des Landes Berlin vorgestellt.
Der Lehrer sieht in dem Video hingegen keinen Grund für eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Er habe mit dem privaten Video ausschließlich scharfe Kritik an der Äußerung des bayrischen Ministerpräsidenten üben und deutlich machen wollen, dass diese der menschen- und rechtsverachtenden Polemik des Nationalsozialismus nahekomme. Das Video sei durch das Grundrecht auf Meinungsäußerung und Kunstfreiheit gedeckt.
So sah es das Arbeitsgericht
Das ArbG hat die Kündigungsschutzklage des Lehrers abgewiesen. Eine Auslegung des Inhalts des Videos ergebe nicht nur eine Kritik an der Äußerung des bayrischen Ministerpräsidenten, sondern auch an der allgemeinen, auch vom Land Berlin und der Schulsenatorin getragenen Impfpolitik. Dabei überschreite der Lehrer durch den Vergleich des Bildes mit dem Text „IMPFUNG MACHT FREI“ mit der Impfpolitik das Maß der zulässigen Kritik. Die Kritik des Lehrers sei nicht mehr durch die Grundrechte der Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit gedeckt, sondern stelle eine unzulässige Verharmlosung des Holocausts dar. Eine Weiterbeschäftigung des Lehrers sei aus diesem Grund unzumutbar.
Quelle | ArbG Berlin, Urteil vom 12.9.2022, 22 Ca 223/22
Baurecht
Nachbarschaftsstreit: Überschwenken eines Baukrans
Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat entschieden: Ein durch einen über sein Grundstück schwenkenden Kranarm beeinträchtigter Nachbar hat einen Unterlassungsanspruch.
Das war geschehen
Die Eigentümer zweier benachbarter Grundstücke gerieten über den Abbruch und die Neubebauung in Streit. Nach Erhalt der Baugenehmigung für zwei Doppelhäuser und vier Garagen haben die Beklagten Ende 2021 einen 18 Meter hohen Turmdrehkran mit ca. 28 Meter langem Ausleger auf der Grundstücksgrenze aufgestellt. Der Ausleger überschwenkte ohne Vorankündigung mehrfach und für längere Zeit im Frühjahr 2022 – mit und ohne Last – den Luftraum über dem klägerischen Grundstück. In einem Fall blieb der Kran mit schweren Betonfertigteilen an der Oberleitung hängen, die auch das klägerische Grundstück mit Strom versorgte. Dadurch wurde u.a. das Dachgeschoss des Hauses des Klägers erschüttert.
Landgericht: Überschwenken erlaubt, aber ohne Lasten
Der Kläger beantragte daher, es unverzüglich zu unterlassen, sein Grundstück mit dem Kran zu überschwenken. Das Landgericht (LG) bejahte diesen Anspruch, jedoch nur im Fall eines Überschwenkens mit Lasten. Dagegen richtet sich die Berufung des Klägers, der seinen Antrag auf Unterlassung auch eines lastenfreien Schwenkens des Kranarms beim OLG weiterverfolgte.
Oberlandesgericht: Überschwenken in jedem Fall untersagt
Das OLG sah die Berufung als begründet an und untersagte das Schwenken des Baukrans über dem Grundstück des Klägers bei Ordnungsgeld-Androhung für jeden Fall der Zuwiderhandlung.
Die Beklagten hätten das im Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg (NRG BW) auch für das Einschwenken eines Baukrans in den nachbarlichen Luftraum vorgesehene Verfahren nicht eingehalten. Daher könnten sich die Bauherren nicht auf das sog. Hammerschlags- und Leiterrecht (nach § 7d NRG BW) und eine entsprechende Duldungspflicht des Klägers berufen. Nach den gesetzlichen Vorgaben hätten die Bauherren das Benutzen des Nachbargrundstücks durch Überschwenken des Krans – mit oder ohne Lasten – zwei Wochen vor der Benutzung anzeigen müssen, was unstreitig nicht erfolgt war. Hätte der Kläger dem Überschwenken dann nicht zugestimmt, hätten die Beklagten erst Duldungsklage erheben müssen und auch dann nicht ihr vermeintliches Recht im Wege der Selbsthilfe durchsetzen können.
Diese Entscheidung im einstweiligen Verfügungsverfahren ist rechtskräftig. Allerdings können die Beklagten noch in einem Hauptsacheverfahren gerichtlich klären lassen, ob ihnen ein Duldungsanspruch auf Überschwenken des Krans gegen den Kläger zusteht.
Quelle | OLG Stuttgart, Urteil vom 31.8.2022, 4 U 74/22, PM vom 8.9.2022
Nichterfüllung vertraglicher Pflichten: Bau einer Moschee zu langsam: Stadt erhält Grundstück
Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat einen beklagten muslimischen Verein für Kultur, Bildung und Integration u.a. zur Rückübertragung des Erbbaurechts eines mit einer Moschee bebauten Grundstücks verpflichtet und dessen Begehren auf Übertragung des Eigentums an diesem Grundstück abgewiesen.
Das war geschehen
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen und der Verein hatten 2014 einen Erbbaurechtsvertrag geschlossen, nach dem die Stadt als Grundstückseigentümerin u.a. eine Rückübertragung des Erbbaurechts bei einer Nichterfüllung vertraglicher Pflichten verlangen kann. Über dieses sog. Heimfallrecht sowie die Ausübung eines Wiederkaufsrechts durch die Stadt streiten die Parteien, nachdem der beklagte Verein als Bauherr seinen vertraglichen Pflichten nicht nachgekommen ist: Der Verein hatte in einem 1. Bauabschnitt die Moschee und ein Kulturhaus nicht fristgerecht bis zum 31.10.2018 – und auch noch nicht bis zum Sommer 2022 – fertiggestellt. Dennoch hatte der Beklagte den vereinbarten Kaufpreis für das Moscheegrundstück in Höhe von über 800.00 Euro bereits 2018 an die Stadt bezahlt. Er wurde aber noch nicht als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Die Stadt übte daraufhin ihr Wiederkaufsrecht aus und beanspruchte auch den Heimfall des Erbbaurechts.
Landgericht gab der Stadt Recht
In erster Instanz verurteilte das Landgericht (LG) Stuttgart den beklagten Verein auf Übertragung des Erbbaurechts und wies demgegenüber den Anspruch des Vereins auf Übertragung des Eigentums an dem Moscheegrundstück zurück.
Beide Parteien: Berufung eingelegt
Mit ihren jeweiligen Berufungen machten die Parteien weitergehende Ansprüche geltend. Die Stadt beansprucht Erbbauzinszahlungen sowie einen Nachweis der Versicherung des Moscheebauwerks. Der Verein will nach wie vor die Auflassung und das Eigentum an dem Grundstück, da die Klägerin ihr Wiederkaufsrecht rechtswidrig ausgeübt habe. Dadurch sei der Kulturverein in seinen Grundrechten auf Religionsfreiheit und seinem Eigentum am Gebäude verletzt.
Nach dem Scheitern der Vergleichsverhandlungen der Parteien hat das OLG die erstinstanzliche Entscheidung zugunsten der Stadt bestätigt und ihr Ansprüche aus dem Erbbaurechtsvertrag zugesprochen. Der Verein muss die Rückübertragung des Erbbaurechts erklären, das Moscheebauwerk bis dahin entsprechend versichern und Erbbauzinsen von über 110.000 Euro nachzahlen. Der Kaufvertrag wird rückabgewickelt und die Stadt bleibt Eigentümerin des Grundstücks.
Oberlandesgericht: Verein hätte fristgerecht bauen müssen
Das OLG begründet dies damit, dass der Verein seiner vertraglich bindenden Zusage, die Moschee fristgerecht herzustellen, schuldhaft nicht nachgekommen sei. Durch die Kaufpreiszahlung des Vereins seien seine Verpflichtungen – wie z.B. auf Versicherungsschutz des Bauwerks – aus dem dinglichen Erbbaurechtsvertrag nicht fortgefallen, sondern wirkten fort.
Bei dem Heimfallrecht und dem Wiederkaufsrecht handle es sich um verschiedene Rechte, die die Stadt beide – mit unterschiedlichen Folgen – ausgeübt habe. Insbesondere sei die Vereinbarung über das Wiederkaufsrecht, wenn der Verein nicht rechtzeitig den 1. Bauabschnitt fertigstelle, wirksam. Der Verein habe keinen Anspruch, genau auf dem streitgegenständlichen Grundstück seinen Mitgliedern die Religionsausübung zu ermöglichen. Vielmehr habe er die Bedingungen des Erbbaurechtsvertrags nicht eingehalten und dadurch das Heimfallrecht ausgelöst. Zugleich sei das vorgesehene Wiederkaufsrecht auch nicht unwirksam und entspreche einer angemessenen Vertragsgestaltung, da der Beklagte in diesem Fall einen wirtschaftlichen Ausgleich seiner Verwendungen erhalte.
Weitere Gerichte müssen entscheiden
Allerdings könne der Verein erst in weiterem Rechtsstreit eine angemessene Entschädigung für die Erhöhung des Grundstückswerts durch seine Aufwendungen geltend machen, um dann an anderer Stelle eine Gebetsmöglichkeit für seine Mitglieder zu schaffen. Der Senat hat die Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) gegen dieses Urteil wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen.
Quelle | OLG Stuttgart, Urteil vom 13.9.2022, 10 U 278/21
Familien- und Erbrecht
Waldorfschule: Privatschulkündigung: Wenn Eltern wegen Corona-Maßnahmen drohen
Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat jetzt eine Privatschulkündigung nach Drohungen von Eltern wegen Corona-Schutzmaßnahmen bestätigt.
Die Eltern hatten gegenüber Lehrkräften und der Geschäftsleitung einer Freien Waldorfschule Drohungen, Unterstellungen und Vorwürfe im Hinblick auf die schulische Umsetzung der staatlichen Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Daraufhin kündigte der beklagte Schulverein die Schulverträge für die Töchter. Der Eilantrag sowie die Beschwerde der Eltern dagegen blieben erfolglos.
Das OLG sagt: Die Eltern könnten sich nicht auf das Schulgesetz des Landes Baden-Württemberg (hier: § 90 Abs. 6 Schulgesetz BW) berufen. Dieser sieht einen Schulausschluss nur beim Fehlverhalten der Schüler. Diese Regelung gilt nicht für Schulen in freier Trägerschaft, da diese sich im Rahmen des grundgesetzlichen Rechts zur freien Schülerwahl von Schülern auch wieder trennen können müssten.
Nach dem OLG war hier zwischen den Interessen der Töchter daran, den Schulvertrag fortzusetzen und den Interessen der Privatschule daran, ihre Bildungsziele effektiv zu verwirklichen, abzuwägen: Beruhe das Konzept auf einer individuellen Betreuung der Schüler, müssten sich Schüler wie Eltern einordnen. Andernfalls bestehe ein billigenswertes Interesse der Schule daran, sich vom Vertrag lösen zu können. Die Kündigungen seien nicht rechtsmissbräuchlich.
Die Eltern könnten sich angesichts ihres unangemessenen Verhaltens, das verschwörungstheoretische Anleihen nehme und sich auf konkrete Drohungen und Unterstellungen erstrecke, nicht auf das grundgesetzliche Recht der Meinungsäußerung berufen. Ziel sei nicht gewesen, einen kritischen Diskurs zu unterbinden.
Quelle | OLG Stuttgart, Beschluss vom 7.9.2022, 4 W 75/22
Verweigerung des Schulbesuchs: Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht für Erstklässler vorläufig entzogen
Eine Kindeswohlgefährdung kommt in Betracht, wenn Eltern – erst wegen der Corona-Maßnahmen, dann wegen einer bevorzugten häuslichen Beschulung – den Schulbesuch ihres Kindes verweigern. So hat es das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe klargestellt.
Ein Erstklässler, der 2021 eingeschult wurde, war bis zum Ende des Schuljahrs wegen der Corona-Maßnahmen nicht einmal in der Schule. Auch anschließend fehlte er, weil er sich durch das Homeschooling, so seine Eltern, „toll“ entfalte.
Das Amtsgericht (AG) erteilte den Eltern das Gebot, die Schulpflicht einzuhalten. Das OLG, das über deren Beschwerde entscheiden musste, hat per einstweiliger Anordnung den Eltern in Bezug auf die schulischen Angelegenheiten das Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht für den Erstklässler vorläufig entzogen und die Aufgaben auf das Jugendamt übertragen.
Das OLG sah Anhaltspunkte für eine erhebliche Kindeswohlgefährdung. Die Schulpflicht dient auch dem staatlichen Erziehungsauftrag und den dahinterstehenden Gemeinwohlinteressen. Hier setzen die Eltern ihre eigene Einschätzung über die Bedeutung der Schulpflicht einfach an die Stelle der gesetzgeberischen Entscheidung. Durch dieses Verhalten wird nicht nur die Entwicklung des Erstklässlers zu einer selbstverantwortlichen Persönlichkeit, sondern auch dessen gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft gefährdet. Wichtig: Der Wille des Erstklässlers, zu Hause beschult zu werden, spielt laut OLG keine Rolle. Denn eine so weitreichende Entscheidung kann einem siebenjährigen Kind nicht anvertraut werden.
Quelle | OLG Karlsruhe, Beschluss vom 16.8.2022, 5 UFH 3/22
Testament: Hypothetischer Wille eines dementen Erblassers zugunsten eines früheren Lebenspartners
Das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg hat die Frage entschieden, ob der in einem Testament manifestierte Wille des Erblassers auch für den Fall gelten sollte, dass sich sein Lebensgefährte noch während seiner Demenzerkrankung einem anderen Lebenspartner zuwendet.
Der Antragsteller ist der ehemalige Lebensgefährte des Erblassers. Aus dessen mittlerweile geschiedenen früheren Ehe ist eine Tochter hervorgegangen. Der Erblasser hat den Antragsteller und seine Tochter mit Testament vom 5.6.2005 zu Erben eingesetzt. Am 17.10.2016 wurde der Erblasser aufgrund weit fortgeschrittener Demenz in eine Klinik eingeliefert und ab dem 15.11.2016 stationär in einer Pflegeeinrichtung betreut. Am 15.8.2020 heiratete der Antragsteller einen neuen Lebenspartner. Im Jahr 2021 verstarb der Erblasser.
Die Tochter hat die am 5.6.2005 errichtete letztwillige Verfügung des Erblassers aufgrund eines Motivirrtums angefochten, soweit dort der Antragsteller zum Erben bestimmt ist. Zur Begründung hat sie vorgetragen, dass der Erblasser bei Kenntnis der Tatsache, dass der Antragsteller sich einem neuen Lebensgefährten zuwendet und diesen auch heiratet, sein Testament geändert hätte. Das Amtsgericht (AG) hingegen hat mit angefochtenem Beschluss die für die Erteilung des beantragten Erbscheins erforderlichen Tatsachen zugunsten des Antragstellers als festgestellt angesehen. Dem ist das OLG gefolgt.
Eine Verfügung von Todes wegen, durch die der Erblasser (u. a.) seinen Lebenspartner bedacht hat, sei zwar unwirksam, wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht. Eine Ausnahme gelte aber, wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser die Verfügung auch für einen solchen Fall getroffen hätte. Dabei kommt es auf den hypothetischen Willen des Erblassers zur Zeit der Errichtung der Verfügung von Todes wegen an. Nach ausführlicher Würdigung der besonderen Umstände kam das OLG zu dem Schluss, dass vorliegend von einer derartigen Ausnahme auszugehen und die Verfügung noch wirksam sei.
Quelle | OLG Oldenburg, Beschluss vom 26.9.2022, 3 W 55/22
Mietrecht und WEG
Ortsübliche Vergleichsmiete: Keine separate Dusche, aber dennoch Duschmöglichkeit
Das Fehlen einer separaten Dusche kann nicht mit einer fehlenden Duschmöglichkeit gleichgesetzt werden. So hat es das Amtsgericht (AG) Berlin-Mitte entschieden.
Es gab Streit um eine Mieterhöhung auf die ortsüblichen Vergleichsmiete auf der Grundlage des Berliner Mietspiegels 2019. Im Badezimmer der Wohnung gab es eine Badewanne, in der eine Haltestange und ein Brausekopf montiert waren. Der Mieter behauptete, das Badezimmer verfüge über keine Duschmöglichkeit und widersprach der Mieterhöhung. Der Vermieter erhob Klage.
Das AG gab ihm Recht. Durch das Fehlen einer separaten Dusche ist das wohnwertmindernde Merkmal „keine Duschmöglichkeit“ nicht erfüllt. Der Mieter mache zwar geltend, ohne Duschwand oder eine sonstige vergleichbare Ausstattung nur die Möglichkeit zu haben, im Sitzen zu duschen. Allerdings könne das Duschen in der Badewanne, auch wenn im Sitzen, nicht mit dem Fehlen einer Duschmöglichkeit gleichgesetzt werden. Denn die Badewanne sei mit einer Haltestange und einem Brausekopf ausgestattet. Das Duschen sei in dieser Form möglich.
Quelle | AG Berlin-Mitte, Urteil vom 10.2.2022, 21 C 280/20
Gebäudeversicherungsvertrag: Verteilung des Selbstbehalts auf die WEG-Eigentümer
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden: Bei einem Leitungswasserschaden, der im räumlichen Bereich des Sondereigentums eingetreten ist, ist der im Gebäudeversicherungsvertrag vereinbarte Selbstbehalt – vorbehaltlich einer abweichenden Regelung – von allen Wohnungseigentümern gemeinschaftlich zu tragen.
Das war geschehen
Die Parteien bilden eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Zur Anlage gehören die Wohnungen der Beklagten und die gewerbliche Einheit der Klägerin. Die Gemeinschaft unterhält eine Gebäudeversicherung, die u. a. auch Leitungswasserschäden abdeckt (sog. verbundene Gebäudeversicherung). Der Versicherungsschutz besteht für das gesamte Gebäude, ohne dass zwischen Sonder- und Gemeinschaftseigentum unterschieden wird. In der Vergangenheit traten aufgrund mangelhafter Kupferrohre wiederholt Wasserschäden in den Wohnungen der Beklagten auf, die sich allein im Jahr 2018 auf rund 85.000 Euro beliefen. Die Gemeinschaft machte deshalb vor Gericht Ansprüche gegen das Unternehmen geltend, das die Leitungen verlegt hatte.
Bislang war die Praxis in der Gemeinschaft so, dass die Verwalterin bei einem Wasserschaden ein Fachunternehmen mit der Schadensbeseitigung beauftragte und die Kosten von dem Gemeinschaftskonto beglich. Sie nahm die Versicherung in Anspruch und legte die Kosten unter Abzug der Versicherungsleistung nach Miteigentumsanteilen um, und zwar auch insoweit, als die Schäden im Bereich des Sondereigentums entstanden waren. Aufgrund der Schadenshäufigkeit betrug der in jedem Schadensfall verbleibende Selbstbehalt inzwischen 7.500 Euro. Dies hatte zur Folge, dass die Versicherung nur noch ca. 25 Prozent der Schäden erstattete.
Gestützt auf die Behauptung, die Mängel an den Leitungen seien jeweils hinter den Absperreinrichtungen in den betroffenen Wohneinheiten aufgetreten, verlangte die Klägerin mit ihrer Klage eine von der bisherigen Praxis abweichende Verteilung des Selbstbehalts. Sie wollte erreichen, dass sie nicht aufgrund des im Versicherungsvertrag vereinbarten Selbstbehalts anteilig an den Kosten für die Beseitigung von Leitungs- und Folgeschäden beteiligt wird, die nach ihrer Ansicht ausschließlich an dem Sondereigentum der Beklagten entstanden sind; auch verwies sie darauf, dass in ihrer Einheit bislang kein Schaden aufgetreten ist.
Das Amtsgericht (AG) hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin vor dem Landgericht (LG) ist erfolglos geblieben. Dagegen hat sich die Klägerin mit der zugelassenen Revision zum BGH gewandt. Keinen Erfolg hatte die Revision, soweit sich die Klägerin gegen die Rechtmäßigkeit der derzeitigen Verwaltungspraxis wandte. Erfolgreich war sie jedoch, soweit sie eine künftige Änderung des Kostenverteilungsschlüssels begehrte. Insoweit hat der BGH das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das LG zurückverwiesen.
Gericht kann hier keinen WEG-Beschluss ersetzen
Der BGH: Die in der Gemeinschaft derzeit praktizierte Verteilung des Selbstbehalts bei einem Leitungswasserschaden nach Miteigentumsanteilen ist rechtmäßig. Die Klägerin kann nicht verlangen, dass ein ihrer Rechtsauffassung entsprechender Beschluss durch das Gericht ersetzt wird. Zwar stellt nach versicherungsrechtlichen Maßstäben die Vereinbarung eines Selbstbehalts im Versicherungsvertrag, bei dem der Versicherer einen bestimmten Betrag des versicherten Schadens nicht ersetzen muss, einen Fall der bewussten Unterversicherung dar. Es würde jedoch der Interessenlage der Wohnungseigentümer bei Abschluss einer verbundenen Gebäudeversicherung nicht gerecht, wenn der geschädigte Sondereigentümer den Selbstbehalt allein tragen müsste. Die Entscheidung für einen Selbstbehalt im Versicherungsvertrag ist regelmäßig damit verbunden, dass die Gemeinschaft als Versicherungsnehmerin eine herabgesetzte Prämie zahlen musste. Das ist für die Wohnungseigentümer wegen der damit einhergehenden Verringerung des Hausgeldes wirtschaftlich sinnvoll. Von sonstigen Fällen einer bewussten Unterversicherung unterscheidet sich der Selbstbehalt wegen des typischerweise überschaubaren und genau festgelegten Risikos. Grundlage der Entscheidung zugunsten eines Selbstbehalts ist dabei die Erwartung der Wohnungseigentümer, dass dieses durch Mehrheitsentscheidung eingegangene Risiko für alle vom Versicherungsumfang erfassten Sachen gemeinschaftlich getragen wird.
Änderung des zukünftigen Verteilungsschlüssels erfordert einen Beschluss
Soweit die Klägerin erreichen wollte, dass der Selbstbehalt bei einem Schaden am Sondereigentum der Wohneinheiten allein von den Eigentümern der Wohneinheiten getragen wird, während sie ihrerseits für den Selbstbehalt bei einem Schaden am Sondereigentum der gewerblichen Einheit aufkommen muss, war das so zu verstehen, dass der derzeit maßgebliche Verteilungsschlüssel für die Zukunft geändert werden soll. Hierzu sind die Wohnungseigentümer befugt. Ein Anspruch eines einzelnen Wohnungseigentümers (wie der Klägerin) auf eine solche Beschlussfassung ist aber nur gegeben, wenn ein Festhalten an der geltenden Regelung aus schwerwiegenden Gründen unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Rechte und Interessen der anderen Wohnungseigentümer, unbillig erscheint.
Zurückverweisung an das Landgericht
Da es insoweit an hinreichenden Feststellungen fehlte, hat der BGH die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Das LG ist nun also wieder am Zug. Für das weitere Verfahren hat der BGH darauf hingewiesen, dass eine – im Vergleich zu den übrigen Eigentümern – unbillige Belastung der Klägerin in Betracht kommen könnte, wenn das (alleinige bzw. jedenfalls überwiegende) Auftreten der Leitungswasserschäden im Bereich der Wohneinheiten auf baulichen Unterschieden des Leitungsnetzes in den Wohneinheiten einerseits und der Gewerbeeinheit andererseits beruhen sollte. Nicht ausreichend wäre es demgegenüber, wenn die Ursache bei gleichen baulichen Verhältnissen in einem unterschiedlichen Nutzungsverhalten läge. Das wird für das weitere Verfahren zu berücksichtigen sein.
Quelle | BGH, Urteil vom 16.9.2022, V ZR 69/21, PM 135/22
Verbraucherrecht
BGH-Entscheidung: Zulässigkeit einer negativen Bewertung bei eBay
Bewertungen im Internet haben eine hohe Relevanz: Ob Kaufabsichten, Reisebuchungen oder Arztbesuche – nahezu alles wird anhand von Erfahrungsberichten und Bewertungen „abgecheckt“. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun über die Frage entschieden, unter welchen Voraussetzungen der Verkäufer, der ein Produkt über die Internetplattform eBay verkauft, einen Anspruch gegen den Käufer auf Entfernung einer abgegebenen negativen Bewertung hat.
Das war geschehen
Der Beklagte erwarb von der Klägerin über die Internetplattform eBay vier Gelenkbolzenschellen für 19,26 Euro brutto. Davon entfielen 4,90 Euro auf die dem Beklagten in Rechnung gestellten Versandkosten. Der Verkauf erfolgte auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt maßgeblichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von eBay, denen die Parteien vor dem Geschäft zugestimmt hatten. Dort heißt es auszugsweise unter „§ 8 Bewertungen“, dass der Nutzer verpflichtet ist, in den abgegebenen Bewertungen ausschließlich wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Die von Nutzern abgegebenen Bewertungen müssen sachlich gehalten sein und dürfen keine Schmähkritik enthalten. Nach Erhalt der Ware bewertete der Beklagte das Geschäft in dem von eBay zur Verfügung gestellten Bewertungsprofil der Klägerin mit dem Eintrag „Ware gut, Versandkosten Wucher!!“.
Bundesgerichtshof: Bewertung muss nicht entfernt werden
Der BGH hat nun entschieden, dass der Klägerin ein Anspruch auf Entfernung der Bewertung „Versandkosten Wucher!!“ nicht zusteht, auch nicht unter dem vom Berufungsgericht herangezogenen Gesichtspunkt einer (nach-)vertraglichen Nebenpflichtverletzung. Anders, als das Berufungsgericht es gesehen hat, enthält der o. g. § 8 der eBay-AGB über die bei Werturteilen ohnehin allgemein geltende (deliktsrechtliche) Grenze der Schmähkritik hinaus keine strengeren vertraglichen Beschränkungen für die Zulässigkeit von Werturteilen in Bewertungskommentaren.
Klausel ist nicht eindeutig: Was bedeutet „sachlich“?
Zwar ist der Wortlaut der Klausel nicht eindeutig. Für das Verständnis, dem dort enthaltenen Sachlichkeitsgebot solle gegenüber dem Verbot der Schmähkritik ein eigenständiges Gewicht nicht zukommen, spricht aber bereits der Umstand, dass hier genaue Definitionen zu dem unbestimmten Rechtsbegriff „sachlich“ in den AGB fehlen. Es liegt in diesem Fall im wohlverstandenen Interesse aller Beteiligten, die Zulässigkeit von grundrechtsrelevanten Bewertungen eines getätigten Geschäfts an den gefestigten Grundsätzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Schmähkritik auszurichten und hierdurch die Anforderungen an die Zulässigkeit von Bewertungskommentaren für die Nutzer und eBay selbst möglichst greifbar und verlässlich zu konturieren.
Zudem hätte es der gesonderten Erwähnung der Schmähkritikgrenze nicht bedurft, wenn dem Nutzer schon durch die Vorgabe, Bewertungen sachlich zu halten, eine deutlich schärfere Einschränkung hätte auferlegt werden sollen. Außerdem würde man der grundrechtlich verbürgten Meinungsfreiheit des Bewertenden von vorherein ein geringeres Gewicht beimessen als den Grundrechten des Verkäufers, wenn man eine Meinungsäußerung eines Käufers regelmäßig bereits dann als unzulässig einstufte, wenn sie herabsetzend formuliert ist und/oder nicht (vollständig oder überwiegend) auf sachlichen Erwägungen beruht. Eine solche, die grundrechtlichen Wertungen nicht hinreichend berücksichtigende Auslegung entspricht nicht dem an den Interessen der typischerweise beteiligten Verkehrskreise ausgerichteten Verständnis redlicher und verständiger Vertragsparteien.
Grenze zur Schmähkritik war nicht überschritten
Die Grenze zur Schmähkritik ist durch die Bewertung „Versandkosten Wucher!!“ nicht überschritten. Wegen seiner das Grundrecht auf Meinungsfreiheit beschränkenden Wirkung ist der Begriff der Schmähkritik nach der Rechtsprechung des BGH eng auszulegen. Auch eine überzogene, ungerechte oder gar ausfällige Kritik macht eine Äußerung für sich genommen noch nicht zur Schmähung. Hinzutreten muss vielmehr, dass bei der Äußerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung des Betroffenen im Vordergrund steht, der jenseits polemischer und überspitzter Kritik herabgesetzt und gleichsam an den Pranger gestellt werden soll.
Kritik in scharfer Form, aber keine Diffamierung
Daran fehlt es hier. Bei der Bewertung „Versandkosten Wucher!!“ steht eine Diffamierung der Klägerin nicht im Vordergrund. Denn der Beklagte setzt sich – wenn auch in scharfer und möglicherweise überzogener Form – kritisch mit einem Teilbereich der gewerblichen Leistung der Klägerin auseinander, indem er die Höhe der Versandkosten beanstandet. Die Zulässigkeit eines Werturteils hängt nicht davon ab, ob es mit einer Begründung versehen ist.
Quelle | BGH, Urteil vom 28.9.2022, VIII ZR 319/20, PM 141/22
Immobiliar-Verbraucherdarlehen: Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung
Ein häufiger Streitpunkt, der die Gerichte beschäftigt, ist die von Banken geforderte Vorfälligkeitsentschädigung. Die Durchsetzung des Anspruchs auf Vorfälligkeitsentschädigung seitens der darlehensgebenden Bank setzt auch beim Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag nicht voraus, dass die für die genaue Berechnung zugrunde zu legenden Größen bereits im Darlehensvertrag präzise definiert sind. Vielmehr genügt es, die wesentlichen Parameter in groben Zügen zu nennen. So sieht es das Oberlandesgericht (OLG) Saarbrücken.
Der Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung ist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (hier: § 502 Abs. 2 Nr. 2 BGB) ausgeschlossen, wenn im Vertrag die Angaben über die Laufzeit des Vertrags, das Kündigungsrecht des Darlehensnehmers oder die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung unzureichend sind. Welche Angaben zur Berechnung erforderlich sind, ist allerdings weder gesetzlich noch abschließend in der Rechtsprechung geklärt.
Das OLG hat daher klargestellt: Einer Differenzierung zwischen „Zinsbindungsfrist“ und „rechtlich geschützter Zinserwartung“ bedarf es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Beachten Sie | Das in diesem Verfahren beklagte Kreditinstitut hatte die finanzmathematischen Rahmenbedingungen zur Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung skizziert und nach Ansicht des OLG sämtliche wesentlichen Parameter dargestellt, die nach allen ernsthaft vertretenen Ansichten gefordert werden.
Diese sind:
- der geschuldete Kreditbetrag und die Restlaufzeit bis zum Ende der Zinsbindung,
- die Differenz zwischen Darlehenszinssatz und der erzielten Wiederanlagerendite aus den zurückgeflossenen Darlehensmitteln,
- die schadensmindernd zu berücksichtigenden ersparten Verwaltungsaufwendungen und die eingesparte Risikomarge sowie
- die Abzinsung des auf dieser Grundlage ermittelten Schadens.
Quelle | OLG Stuttgart, Urteil vom 18.5.2022, 9 U 237/21
Verkehrsrecht
Betriebsgefahr: Rettungswagen im Einsatz: Bei Unfall Schmerzensgeld möglich
Rettungswagen sollen Leib und Leben von Menschen retten und schützen. Manchmal kann es bei einem Einsatz aber auch zu Personenschäden kommen. So geschah es in einem vom Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg entschiedenen Fall, in dem das OLG den Rettungsdienst verurteilte, Schmerzensgeld zu zahlen.
Der Fahrer eines Rettungswagens wollte bei einem Einsatz mehrere Radfahrer überholen, darunter die Klägerin. Das Martinshorn war eingeschaltet. Es gab insgesamt nur wenig Platz. Die 72-jährige Klägerin wollte in dieser Situation absteigen und kam dabei zu Fall. Zu einer Kollision war es nicht gekommen. Die Frau brach sich den Fußknöchel und musste zwei Wochen einen Gipsverband tragen sowie im Anschluss noch zwei Monate einen speziellen Strumpf.
Das Landgericht (LG) hatte eine Haftung des Rettungsdienstes abgelehnt. Mit ihrer Berufung hatte die Klägerin vor dem OLG Erfolg. Dieses entschied: Bei dem Vorfall habe sich die sog. „Betriebsgefahr“ des Rettungswagens realisiert, also die typischerweise einem Kfz beim Betrieb innewohnende Gefahr. Dies gelte, auch wenn es nicht zu einer Kollision gekommen sei. Denn der Rettungswagen habe dennoch zu dem Unfall beigetragen, indem er das Ausweichmanöver und das Absteigen der Klägerin veranlasst habe. Ein Schaden sei bereits dann „beim Betrieb“ eines Kfz entstanden, wenn sich die von dem Kfz ausgehende Gefahr überhaupt ausgewirkt habe. Das sei hier der Fall. Die Klägerin habe die Verkehrslage zu Recht als gefährlich empfunden und sei deswegen abgestiegen.
Das OLG hat die Betriebsgefahr mit 20% Haftungsquote bewertet und der Radfahrerin ein Schmerzensgeld von 2.400 Euro zugesprochen. Darüber hinaus erhält sie auch ihren materiellen Schaden zu 20% ersetzt, ebenso wie die Kosten für ihren Rechtsanwalt.
Die Entscheidung ist rechtskräftig.
Quelle | OLG Oldenburg, Urteil vom 17.5.2022, 2 U 20/22, PM vom 27.9.2022
Nutzungsausfallentschädigung: Porsche-Fahrer muss mit Ford Mondeo zurechtkommen
Ist einem Unfallgeschädigten während der Reparaturzeit des beschädigten Fahrzeugs die Nutzung eines Zweitwagens möglich und zumutbar, besteht kein Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung gegen den Schädiger. Bei Beschädigung eines Porsche 911 ist die Nutzung eines Ford Mondeo für Stadt- und Bürofahrten zumutbar. Die damit verbundene Einschränkung des Fahrvergnügens stellt einen immateriellen und damit nicht ersatzpflichtigen Schaden dar, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main.
Das war geschehen
Das Fahrzeug des Klägers, ein Porsche 911, wurde bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Beklagte haftete für den Schaden vollumfänglich. Der Beklagte glich einen Teil des geltend gemachten Schadens aus. Mit seiner Klage begehrt der Kläger u.a. Ausgleich der verbliebenen Differenz zu den tatsächlich entstandenen Reparaturkosten und Nutzungsentschädigung für 112 Tage Reparaturzeit.
Privater Fuhrpark war vorhanden
Der Kläger verweist darauf, dass ihm die Nutzung eines anderen Fahrzeugs nicht möglich bzw. nicht zumutbar gewesen sei. Ihm gehörten zwar noch weitere vier Fahrzeuge. Zwei davon würden jedoch von Familienangehörigen genutzt. Ein weiteres käme nicht in Betracht, da es in besonderer Weise für Rennen ausgestattet sei. Das vierte Fahrzeug, ein Ford Mondeo, sei für den Stadtverkehr zu sperrig und werde von der ganzen Familie lediglich als Lasten- und Urlaubsfahrzeug genutzt.
So argumentierten die gerichtlichen Instanzen
Das Landgericht (LG) hatte der Klage hinsichtlich der Reparaturkosten stattgegeben und die Ansprüche auf die geltend gemachte Nutzungsentschädigung zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Berufung hatte auch vor dem OLG keinen Erfolg. Zwar umfasse der zu ersetzende Schaden bei der Beschädigung eines Kraftfahrzeugs grundsätzlich auch den Wegfall der Nutzungsmöglichkeit dieses Fahrzeugs. Ein Geschädigter, der darauf verzichte, ein Ersatzfahrzeug zu mieten, solle nicht schlechter gestellt werden als der, der einen Mietwagen in Anspruch nehme.
Gericht: Es stand ein geeignetes Fahrzeug zur Verfügung
Ein solcher Anspruch entfalle jedoch, wenn der Einsatz eines Zweitwagens möglich und zumutbar sei. Vorliegend hätte der Kläger den Ford Mondeo für die Fahrten zur Arbeit und zu Privatfahrten nutzen können. Ohne Erfolg verweise der Kläger dabei auf die „Sperrigkeit“ dieses zur Mittelklasse gehörenden und für den Stadtverkehr geeigneten Fahrzeuges. Der materielle Vermögensschaden durch den Verlust der Nutzungsmöglichkeit des Porsche 911 werde damit objektiv durch die Möglichkeit der Nutzung des Ford Mondeo ausgeglichen.
Beschränkung des Fahrvergnügens: immaterielle Beeinträchtigung
„Dass es sich bei dem beschädigten Fahrzeug, einem Porsche 911, mithin einem Sportwagen, aufgrund seiner Motorisierung, Fahrleistung und Ausstattung um ein Fahrzeug aus dem deutlich gehobenen Marktsegment handelt, während es sich bei dem Ford Mondeo lediglich um ein Mittelklassefahrzeug handelt, führt nicht zur Unzumutbarkeit der Nutzung des Ford Mondeo,“ betonte das OLG weiter. Die notwendige Nutzung des Ford Mondeo anstelle des Porsche 911 führe „lediglich zu einer Beschränkung des Fahrvergnügens“. Diese Beschränkung stelle allein eine in einer subjektiven Wertschätzung gründende immaterielle Beeinträchtigung dar und sei nicht vom Schädiger zu erstatten. Anderenfalls bestünde die Gefahr, die Ersatzpflicht des Schädigers entgegen den gesetzlichen Wertungen auf Nichtvermögensschäden auszudehnen.
Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.
Quelle | OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 21.7.2022, 11 U 7/21, PM 72/22
Schadensminderungspflicht: Fünf-Tage-Reparatur am fahrfähigen Fahrzeug
Der Geschädigte ist nicht verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Reparatur an einem Montag beginnt, damit keine Verlängerung über das Wochenende zu zwei zusätzlichen Mietwagentagen führt. Dies hat das Amtsgericht (AG) Geestland jetzt entschieden.
Das verunfallte Fahrzeug war noch nutzbar. Die Reparatur sollte laut Gutachten fünf Tage dauern. So geschah es auch. Aber: Mit einem Wochenende wurden sieben Ausfalltage daraus.
Nach Ansicht des AG liegt es nicht in der Hand der Geschädigten, wann Reparaturkapazitäten in der Werkstatt zur Verfügung stehen. Reparaturtermine würden durch die dortigen Abläufe bestimmt; eine freie Terminwahl des Kunden bestehe regelmäßig nicht. Der Versicherer werde nicht ernsthaft behaupten wollen, dass Reparaturwerkstätten ab mittwochs nur noch Kurz- und am Freitag nur noch einen Tag dauernde Reparaturen anbieten dürfen, damit Geschädigte ihrer Schadensminderungspflicht genügen könnten.
Quelle | AG Geestland, Urteil vom 29.7.2022, 3 C 167/22
Hilfsbereitschaft: Gerissenes Abschleppseil: Wer gezogen wird, haftet
Bei einem privaten Abschleppvorgang aus Hilfsbereitschaft riss die Abschleppöse beim gezogenen Fahrzeug ab. Infolge der Spannung schleuderte das Seil nach vorn und beschädigt das ziehende Fahrzeug. Wer muss in einem solchen Fall den Schaden begleichen? Das hat jetzt das Amtsgericht (AG) Regensburg entschieden.
Im Rechtsstreit ließ sich auch unter Zuhilfenahme eines Sachverständigen nicht mehr klären, warum die Abschleppverbindung gerissen ist. Ein Fehler des einen oder des anderen Fahrers hatte weder eine Partei vorgetragen noch nachgewiesen.
Das AG sah keine Haftungsbeschränkung auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Die Risiken eines solchen Vorgangs seien viel zu groß, als dass man von einem bloßen Gefälligkeitsverhältnis ausgehen könne. Weil beide Fahrer angaben, der Abschleppvorgang sei normal verlaufen, es sei insbesondere nicht zu heftig angefahren worden, ordnete das Gericht den Schadeneintritt für den Ziehenden als ein unabwendbares Ereignis ein. So blieb nur die Betriebsgefahr des geschleppten Fahrzeugs. Das überraschende Ergebnis: 100 Prozent Haftung zulasten des gezogenen Fahrzeugs.
Quelle | AG Regensburg, Urteil vom 21.7.2022, 9 C 56/22
Schadenersatz: Mietwagenkosten und Verzögerung: Wer trägt das Risiko?
Der Schädiger bzw. die hinter ihm stehende Haftpflichtversicherung trägt das Risiko von Zeitverzögerungen. Es ist allein deren Aufgabe, möglichst zügig zu entscheiden, um nicht unnötige Kosten zu produzieren. Dies hat das Amtsgericht (AG) Halle (Saale) im Streit um Mietwagenkosten klargestellt.
Der Versicherer hatte wenige Tage länger für die Zusage der Haftung dem Grunde nach gebraucht. Die Reparatur begann erst danach. Der Versicherer meint, weil er ein Recht zur Prüfung habe, könne diese Verzögerung nicht zu seinen Lasten gehen. Der Geschädigte müsse daher entweder sofort die Reparatur einleiten oder die Mietwagenkosten für die Wartezeit selbst zahlen.
Das machte das AG nicht mit. Wie schon der Bundesgerichtshof (BGH) hat es gegen den Versicherer entschieden. Folge: Der Geschädigte musste nicht in Vorleistung treten. Der Schädiger bzw. der hinter dem Schädiger stehende Versicherer trägt das Risiko von Zeitverzögerungen, so das AG. Zweifellos habe der Versicherer das Recht, die Haftung zu prüfen. Der dafür benötige Zeitrahmen gehe aber nicht zulasten des Geschädigten.
Quelle | AG Halle/Saale, Urteil vom 23.8.2022, Az. 97 C 509/22
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
Corona-Pandemie: Kein Schadenersatz wegen Absage einer Messe
Einer Ausstellerin stehen keine Schadenersatzansprüche wegen der im Februar 2020 erfolgten Verschiebung einer für den 8.3. bis 13.3.2020 geplanten Messe auf den Herbst 2020 sowie der vollständigen Absage dieser Messe am 5.5.2020 zu. Beide Entscheidungen waren im Hinblick auf das sich rasant und nicht prognostizierbar entwickelnde Pandemiegeschehen, der Verantwortung für die Gesundheit der Messeteilnehmer und der erheblichen wirtschaftlichen Interessen rechtmäßig, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main.
Das war geschehen
Die Klägerin hatte mit der beklagten Messeveranstalterin einen Vertrag über die Teilnahme an der vom 8.3. bis 13.3.2020 geplanten Messe „Light + Building 2020“ geschlossen. Am 24.2.2020 hatte die Beklagte die Messe im Hinblick auf die Verbreitung des Corona-Virus zunächst auf September 2020 verschoben und letztlich am 5.5.2020 ganz abgesagt. Die bereits entrichteten Standgebühren zahlte sie der Klägerin zurück. Diese begehrt nun u.a. Schadenersatz in Höhe von knapp 75.000 Euro und verweist auf bereits vorgenommene Hotelreservierungen, PR-Maßnahmen, Miete des Messestands und statische Berechnungen. Das Landgericht (LG) hatte die Klage abgewiesen. Die hiergegen gerichtete Berufung hatte auch vor dem OLG keinen Erfolg. Der Klägerin stehe kein Schadenersatzanspruch zu, bestätigte das OLG.
Festhalten am Vertrag nicht zumutbar
Zu der zunächst vorgenommenen Verschiebung der Messe sei die Beklagte berechtigt gewesen. Ihr sei das Festhalten am ursprünglichen Vertrag nicht zumutbar gewesen. Bis zum 24.2.2020 hätten sich die Umstände, die Grundlage des zwischen den Parteien geschlossenen Vertrags geworden waren, so schwerwiegend geändert, dass die Parteien bei Kenntnis dieser veränderten Umstände den Vertrag nicht mehr mit dem alten Inhalt geschlossen hätten. Die „dynamische Entwicklung des Infektionsgeschehens mit dem Corona-Virus vom Jahreswechsel 2019/2020 bis zu ihrer Entscheidung am 24.2.2022, die dadurch bedingten erheblichen Unsicherheiten für die Durchführbarkeit der Veranstaltung und die Verantwortung für Gesundheit und das Leben aller an der Messe teilnehmenden (...) Personen“ hätten die Beklagte zur Verschiebung um ca. sechs Monate berechtigt. Die Entwicklung des Infektionsgeschehens sei rasant und sich stetig verschärfend verlaufen.
Behördliches Verbot wäre wahrscheinlich gewesen
Unerheblich sei, dass am 24.2.2020 kein behördlich angeordnetes Verbot der Veranstaltung bestanden habe. Es habe vielmehr ausgereicht, dass ein behördliches Veranstaltungsverbot bei einer ex ante-Prognose hinreichend wahrscheinlich gewesen sei. Dies sei hier der Fall gewesen. Angesichts der Erklärung des Infektionsgeschehens zu einer Pandemie durch die WHO am 11.3.2020, des am 12.3.2020 erfolgten Verbots von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen (wie hier) und des am 14.3.2020 verhängten vollständigen Verbots von Veranstaltungen wäre es allein vom Zufall abhängig gewesen, ob die Messe gerade noch hätte stattfinden können oder nicht. Die Beklagte habe auch in besonderer Weise die Gesundheit der Messeteilnehmer und die Verhinderung der Infektion einer unübersehbaren Zahl an Personen berücksichtigen dürfen.
Keine Ausnahmegenehmigung möglich
Die endgültige Absage der Messe am 5.5.2020 sei ebenfalls rechtmäßig erfolgt. Nach der damals gültigen Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung hätte die Messe nur mit einer Ausnahmegenehmigung durchgeführt werden können. Diese wäre wohl nicht zu erlangen gewesen. Jedenfalls habe die Lage am 5.5.2020 wegen Störung der Geschäftsgrundlage die Beklagte zu der völligen Beseitigung des Vertragsverhältnisses berechtigt. Am 5.5.2020 sei die Durchführung von Messen bis zum 31.8.2020 verboten gewesen.
Keine Prognose zu Ausweichtermin möglich, Absage war rechtmäßig
„Die Prognose, ob die Durchführung der Messe zu dem geplanten Ausweichtermin möglich sein würde und wenn ja in welchem Umfang, (war) für die Beklagte angesichts der sich ständig überschlagenden und beinahe täglich erfolgenden Neueinschätzungen durch die verantwortlichen Politiker, das RKI und die Wissenschaft kaum zu treffen“, begründete das OLG weiter. Angesichts der wirtschaftlichen Interessen einer Vielzahl von Ausstellern und des Umstands, dass die drohenden Schäden mit der Kurzfristigkeit einer Absage immer größer würden, habe die Beklagte die alle zwei Jahre stattfindende Messe absagen dürfen.
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Mit der Nichtzulassungsbeschwerde kann die Klägerin die Zulassung der Revision beim BGH begehren.
Quelle | OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 7.9.2022, 4 U 331/21, PM 73/22
BGH-Entscheidung: Gutgläubiger Erwerb eines gebrauchten Fahrzeugs
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden: Beruft sich der Erwerber eines gebrauchten Fahrzeugs auf den gutgläubigen Erwerb von einem Nichtberechtigten, muss der bisherige Eigentümer beweisen, dass der Erwerber sich die Zulassungsbescheinigung Teil II (früher: Kraftfahrzeugbrief) nicht hat vorlegen lassen.
Das war geschehen
Die Klägerin, eine Gesellschaft italienischen Rechts, die Fahrzeuge in Italien vertreibt, kaufte im März 2019 unter Einschaltung eines Vermittlers ein Fahrzeug von einem Autohaus, bei dem das Fahrzeug stand. Eigentümerin des Fahrzeugs war die Beklagte, die es an das Autohaus verleast hatte und die auch im Besitz der Zulassungsbescheinigung Teil II ist. Nach Zahlung des Kaufpreises von über 30.000 Euro holte der Vermittler Anfang April 2019 das Auto bei dem Autohaus ab und verbrachte es zu der Klägerin nach Italien. Zwischen den Parteien ist streitig, ob dem Vermittler eine hochwertige Fälschung der Zulassungsbescheinigung Teil II vorgelegt wurde, in der das Autohaus als Halter eingetragen war. Als die Klägerin ein weiteres Fahrzeug von dem Autohaus kaufen wollte, war es geschlossen. Gegen den Geschäftsführer wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts in über 100 Fällen eingeleitet.
Die Entscheidung des BGH
Die Klägerin kann von der Beklagten die Herausgabe der Zulassungsbescheinigung Teil II verlangen, weil sie Eigentümerin des Fahrzeugs geworden ist. Ursprüngliche Eigentümerin des Fahrzeugs war zwar die Beklagte. Zwischen der Klägerin und dem Autohaus hat aber eine Einigung und Übergabe im Sinne stattgefunden. Weil das Fahrzeug dem Autohaus als Veräußerer nicht gehörte, konnte die Klägerin das Eigentum durch diesen Vorgang allerdings nur gutgläubig erwerben. Dass die Klägerin nicht in gutem Glauben war, muss die Beklagte beweisen. Der Gesetzgeber hat die fehlende Gutgläubigkeit im Verkehrsinteresse bewusst als Ausschließungsgrund ausgestaltet. Derjenige, der sich auf den gutgläubigen Erwerb beruft, muss die Voraussetzungen eines solchen Erwerbs beweisen, nicht aber seine Gutgläubigkeit.
Mindesterfordernisse für gutgläubigen Erwerb eines gebrauchten Kfz
Diese Beweislastverteilung gilt auch, wenn die fehlende Gutgläubigkeit des Erwerbers – wie hier – darauf gestützt wird, bei dem Erwerb des Fahrzeugs habe die Zulassungsbescheinigung Teil II nicht vorgelegen. Zwar gehört es nach ständiger Rechtsprechung des BGH regelmäßig zu den Mindesterfordernissen für einen gutgläubigen Erwerb eines gebrauchten Kraftfahrzeugs, dass sich der Erwerber die Zulassungsbescheinigung Teil II vorlegen lässt, um die Berechtigung des Veräußerers zu prüfen. Wird dem Erwerber eine gefälschte Bescheinigung vorgelegt, treffen ihn, sofern er die Fälschung nicht erkennen musste und für ihn auch keine anderen Verdachtsmomente vorlagen, keine weiteren Nachforschungspflichten.
Bisheriger Eigentümer muss Fehlen des guten Glaubens beweisen
Diese Rechtsprechung ist aber nicht so zu verstehen, dass die Vorlage der Zulassungsbescheinigung Teil II von demjenigen zu beweisen wäre, der sich auf den gutgläubigen Erwerb beruft. Denn für die von dem Erwerber zu beweisenden Voraussetzungen des gutgläubigen Erwerbs spielt die Vorlage der Bescheinigung keine Rolle. Sie hat rechtliche Bedeutung nur im Zusammenhang mit dem guten Glauben des Erwerbers; dessen Fehlen muss der gesetzlichen Regelung zufolge der bisherige Eigentümer beweisen.
Erwerber muss aber darlegen, dass er die Papiere überprüft hat
Allerdings trifft den Erwerber, der sich auf den gutgläubigen Erwerb beruft, regelmäßig eine sog. sekundäre Darlegungslast hinsichtlich der Vorlage und Prüfung der Zulassungsbescheinigung Teil II. Er muss also seinerseits vortragen, wann, wo und durch wen ihm die Bescheinigung vorgelegt worden ist und dass er sie überprüft hat. Dann muss der bisherige Eigentümer beweisen, dass diese Angaben nicht zutreffen.
Quelle | BGH, Urteil vom 23.9.2022, V ZR 148/21, PM 138/2022
Berechnung der Verzugszinsen
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022 beträgt -0,88 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent
Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).
Übersicht / Basiszinssätze
| Zeitraum | Zinssatz |
|---|---|
| 01.01.2022 bis 30.06.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2021 bis 31.12.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2021 bis 30.06.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2020 bis 31.12.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2020 bis 30.06.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2019 bis 31.12.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2019 bis 30.06.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2018 bis 31.12.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2018 bis 30.06.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2017 bis 31.12.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2017 bis 30.06.2017 | -0,88 Prozent |