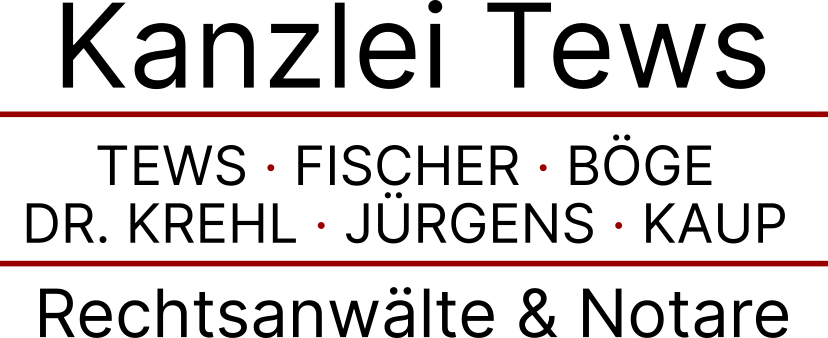Juli 2021
- Juli 2021
Arbeitsrecht
Kündigungsschutzklage: Erst die Abmahnung, dann die Kündigung
Ein Arbeitgeber muss regelmäßig erst einmal abmahnen, bevor er das Arbeitsverhältnis fristlos kündigen kann. Dies gilt insbesondere, wenn der betroffene Arbeitnehmer nur einmal unentschuldigt gefehlt hat und zwar auch, wenn dies bereits am dritten Arbeitstag passiert. Zu diesem Ergebnis kam jetzt das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein.
Das war geschehen
Der Arbeitgeber hatte die Arbeitnehmerin zum 1.8.2019 eingestellt. Nachdem sie am 1. und 2.8. vor dem Wochenende gearbeitet hatte, blieb sie am 5. und 6.8. vereinbarungsgemäß zwecks Kindergarten-Eingewöhnung ihres Sohnes der Arbeit fern. Mit Schreiben vom 5.8. kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis zum 12.8.2019. Am 7.8. fehlte die Arbeitnehmerin unentschuldigt. Für den 8. und 9.8. liegen Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen vor. Mit E-Mail vom 8.8. kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis fristlos. Die Kündigung ging der Arbeitnehmerin am 9.8. schriftlich zu.
Kündigungsschutzklage
Mit ihrer Kündigungsschutzklage wandte sich die Arbeitnehmerin nur noch gegen die zweite, fristlose Kündigung und verlangte, die gesetzliche Kündigungsfrist hinsichtlich der ersten Kündigung einzuhalten. Der Arbeitgeber hielt die fristlose Kündigung für wirksam. Die Arbeitnehmerin habe gerade einmal zwei Tage gearbeitet und dann unentschuldigt gefehlt. Es handele sich um ein „gescheitertes Arbeitsverhältnis“. Hier sei eine Abmahnung entbehrlich gewesen.
Fristlose Kündigung unwirksam
Das LAG hielt die außerordentliche fristlose Kündigung für unwirksam. Eine vorherige Abmahnung sei notwendig. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die Arbeitnehmerin trotz Kündigungsandrohung der Arbeit weiter unentschuldigt ferngeblieben wäre. Ihre Pflichtverletzung sei auch nicht derart schwerwiegend, dass eine Abmahnung ausnahmsweise entbehrlich gewesen wäre. Anders als der Arbeitgeber meint, müsse er die zweiwöchige gesetzliche Kündigungsfrist in der Probezeit einhalten. Die kürzere Frist im Arbeitsvertrag sei unwirksam. Es sei nicht gleichheitswidrig, wenn lediglich den Tarifvertragsparteien die Möglichkeit der Vereinbarung kürzerer Kündigungsfristen zustehe. Deren Verhandlungsparität führe zu einer angemessenen Berücksichtigung der Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Eine vergleichbare Parität bestehe zwischen den Parteien des Individualarbeitsvertrags nicht.
Quelle | LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 3.6.2020, 1 Sa 72/20
Benachteiligungsverbot: Dem potenziellen Arbeitgeber muss Schwerbehinderung des Bewerbers bekannt sein
Der objektive Verstoß des Arbeitgebers gegen Vorschriften, die Verfahrens- und/oder Förderpflichten zugunsten schwerbehinderter Menschen enthalten, kann die Vermutung der Benachteiligung eines erfolglosen schwerbehinderten Bewerbers wegen der Schwerbehinderung nach § 22 AGG regelmäßig nur begründen, wenn der Bewerber den Arbeitgeber rechtzeitig über seine Schwerbehinderung in Kenntnis gesetzt hat. Das hat jetzt das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden.
Die Parteien stritten darüber, ob die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger eine Entschädigung wegen eines Verstoßes gegen das Verbot der Benachteiligung wegen seiner (Schwer)Behinderung zu zahlen.
Sachverhalt
Der Kläger ist Diplom-Verwaltungswirt (FH). Nach seinem Studium war er zunächst stellvertretender Sachgebietsleiter, später Sachgebietsleiter eines Ausländeramts. Dann war er als geschäftsleitender Beamter einer Gemeinde und als Geschäftsleiter einer anderen Gemeinde tätig. In der Zeit von April 1992 bis April 2008 war er erster Bürgermeister. Ausweislich des Bescheids des zuständigen Versorgungsamts von Dezember 2013 ist der Kläger mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 schwerbehindert.
Die Beklagte, die in Teilbereichen der Verwaltungstätigkeit einer großen Kreisstadt gleichgestellt ist, schrieb im September 2017 die Stelle eines/einer Leiter/in des Sachgebietes Bauen und Wohnen aus. Der Kläger bewarb sich auf diese Stelle. Weder im Bewerbungsschreiben noch im beigefügten Lebenslauf informierte er die Beklagte über seine Schwerbehinderung.
Die Beklagte traf in der Folgezeit eine Vorauswahl unter den Bewerbern und lud die von ihr als geeignet erachteten zu Vorstellungsgesprächen ein. Der Kläger war nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Später entschied sich das Auswahlgremium für einen anderen Bewerber.
Benachteiligung lag vor…
Zwar wurde der Kläger dadurch, dass der Beklagte ihn im Auswahl-/Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt hatte, unmittelbar benachteiligt, denn er hat eine weniger günstige Behandlung erfahren als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Darauf, ob es andere Bewerber gegeben hat, ob deren Bewerbungen Erfolg hatten und ob ein von der Beklagten ausgewählter Bewerber die Stelle angetreten hat, kommt es nicht an.
… aber nicht aufgrund der Schwerbehinderung
Der Kläger hat die unmittelbare Benachteiligung jedoch nicht wegen seiner (Schwer)Behinderung erfahren. Eine gesetzliche Vermutung, dass der Kläger die Benachteiligung wegen der (Schwer)Behinderung erfahren hat, ergibt sich weder aus der Nichteinladung des Klägers zu einem Vorstellungsgespräch noch aus sonstigen Umständen: Nach dem Sozialgesetzbuch IX melden die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber den Agenturen für Arbeit frühzeitig freiwerdende und neu zu besetzende sowie neue Arbeitsplätze. Haben schwerbehinderte Menschen sich um einen solchen Arbeitsplatz beworben oder sind sie von der Bundesagentur für Arbeit oder von einem von dieser beauftragten Integrationsfachdienst vorgeschlagen worden, werden sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Eine Einladung ist entbehrlich, wenn die fachliche Eignung offensichtlich fehlt.
Arbeitgeber hatte keine Information über Schwerbehinderung
Hier hat der Arbeitgeber zwar gegen seine Pflicht verstoßen, den Kläger einzuladen. Dafür, dass dieser objektive Verstoß des Arbeitgebers aber wegen der (Schwer)Behinderung geschehen ist, fehlen jegliche Anhaltspunkte. Denn dann hätte dem Arbeitgeber die Schwerbehinderung des Bewerbers bekannt sein müssen. Deshalb muss ein Bewerber, der seine Schwerbehinderung bei der Behandlung seiner Bewerbung berücksichtigt wissen will, den (potenziellen) Arbeitgeber hierüber in Kenntnis setzen, soweit dieser nicht ausnahmsweise, so ggf. bei internen Bewerbern, bereits über diese Information verfügt. Andernfalls fehlt es an der (Mit-)Ursächlichkeit der (Schwer)Behinderung für die benachteiligende Maßnahme.
Quelle | BAG, Urteil vom 17.12.2020, 8 AZR 171/20
Kündigungsschutzklage: Kündigung wegen einer Covid-19-Quarantäne unwirksam
Das Arbeitsgericht (ArbG) Köln hat die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses für unwirksam erklärt, die ein Arbeitgeber aufgrund einer behördlich angeordneten Quarantäne gegenüber seinem Arbeitnehmer ausgesprochen hatte.
Der Arbeitnehmer befand sich auf telefonische Anordnung des Gesundheitsamts im Oktober 2020 als Kontaktperson des positiv auf Covid-19 getesteten Bruders seiner Freundin in häuslicher Quarantäne. Hierüber informierte der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber, einen kleinen Dachdeckerbetrieb. Der Arbeitgeber bezweifelte die Quarantäneanordnung und vermutete, der Arbeitnehmer wolle sich lediglich vor der Arbeitsleistung „drücken“. Er verlangte eine schriftliche Bestätigung des Gesundheitsamts, die der Arbeitnehmer auch beim Gesundheitsamt telefonisch einforderte. Als diese schriftliche Bestätigung des Gesundheitsamts auch nach mehreren Tagen noch nicht vorlag, kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis.
Das ArbG Köln hat der Kündigungsschutzklage stattgegeben. Zwar fand das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung, sodass der Arbeitgeber grundsätzlich keinen Kündigungsgrund für die Rechtswirksamkeit einer fristgerechten Kündigung vor Gericht darlegen musste. Das Gericht sah die Kündigung jedoch als sittenwidrig und treuwidrig an. Der Arbeitnehmer habe sich lediglich an die behördliche Quarantäneanordnung gehalten. Erschwerend kam nach Auffassung des Gerichts hinzu, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer ausdrücklich aufgefordert hatte, entgegen der Quarantäneanweisung im Betrieb zu erscheinen.
Gegen das Urteil kann Berufung beim Landesarbeitsgericht (LAG) Köln eingelegt werden.
Quelle | ArbG Köln, Urteil vom 15.4.2021, 8 Ca 7334/20, PM Nr. 1/2021
Arbeitsunfähigkeit: Freistellung ist kein Urlaub
Genehmigt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen tariflichen Freistellungstag wegen Schichtarbeit, erfüllt er schon hiermit den Anspruch des Arbeitsnehmers. Erkrankt der Arbeitnehmer in diesen Tagen arbeitsunfähig, muss der Arbeitgeber ihn für diese Tage nicht erneut freistellen. Das Risiko einer Erkrankung trägt in diesen Fällen also der Arbeitnehmer. So entschied es jetzt das Landesarbeitsgericht (LAG) Nürnberg.
Etwas anderes gilt nur, wenn dies im Tarifvertrag ausdrücklich geregelt ist. Im hier zugrunde liegenden Tarifvertrag für die bayrische Metall- und Elektroindustrie war dies nicht der Fall. Der Arbeitgeber hatte argumentiert, mit der Genehmigung des Freistellungstags sei dieser freie Tag „verbraucht“. Eine Arbeitsunfähigkeit falle in das Risiko der Arbeitnehmerin. Hiermit hat er sich auf ganzer Linie durchgesetzt.
Das LAG hielt Freistellungstag und Urlaub also für nicht miteinander vergleichbar. Es hat aber wegen der sog. grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache die Revision zum Bundesarbeitsgericht (BAG) zugelassen.
Quelle | LAG Nürnberg, Urteil vom 8.4.2021, 2 Sa 343/20
Baurecht
Vergaberecht: Preisprüfung bei 20 Prozent Differenz zum Zweitplatzierten
Umstände, die die Unangemessenheit des Preises indizieren können, sind die Höhe des Preises und der Abstand zum nächstgünstigen Angebot. Eine Aufklärung kann geboten sein, wenn der Preis erheblich unterhalb einer qualifizierten Kostenschätzung oder Erfahrungswerten liegt. Eine Prüfung der Preisbildung ist angezeigt, wenn der Abstand zwischen dem best- und dem zweitplatzierten Bieter mehr als 20 Prozent beträgt, bestätigte nun das Bayerische Oberlandesgericht (BayObLG).
Unterschiedliche Einschätzungen bestehen nur darüber, ob diese Aufgreifschwelle immer erst bei einem Preisabstand von 20 Prozent zum nächsthöheren Angebot erreicht ist. So haben es z. B. das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf und die Vergabekammer (VK) Rheinland entschieden. Bei einem Preisabstand von unter zehn Prozent zum nächsthöheren Angebot besteht regelmäßig kein Anlass für eine Aufklärung der Angemessenheit der Preise.
Quelle | BayObLG, Beschluss vom 9.4.2021, Verg 3/21; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 25.4.2012, Verg 61/11; VK Rheinland, Beschluss vom 29.7.2019, VK 26/19
Familien- und Erbrecht
BGH-Entscheidung: Scheidung: Auskunftspflicht der Ehegatten
Ist ein Scheidungsantrag bei Gericht rechtshängig, müssen die Ehegatten auf Verlangen des Gerichts Auskunft über ihre Versorgungsanrechte erteilen, auch wenn sie das Vorliegen der Voraussetzungen für die Scheidung bestreiten. Das Gericht darf zur Durchsetzung der Auskunftspflicht Zwangsmittel auch schon festsetzen, bevor geklärt ist, ob der Scheidungsantrag überhaupt begründet ist. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.
Zwischen den Eheleuten war ein Scheidungsverbundverfahren rechtshängig. Beide haben Scheidungsanträge gestellt, die Frau bestritt jedoch den Vortrag des Mannes, dass die Eheleute seit mehr als einem Jahr in der Ehewohnung getrennt leben würden.
Das Amtsgericht (AG) hatte noch keinen Verhandlungstermin bestimmt. Es hatte die Ehegatten dennoch aufgefordert, den ausgefüllten Fragebogen über ihre in der Ehezeit erworbenen Versorgungsanrechte vorzulegen. Nachdem die Frau dieser Aufforderung trotz Androhung von Zwangsmaßnahmen nicht nachgekommen war, hat es gegen sie ein Zwangsgeld in Höhe von 500 Euro, ersatzweise Zwangshaft, festgesetzt.
Die Rechtsmittel der Frau blieben erfolglos. Das liegt auch im Interesse des Scheidungswilligen. Denn so wird verhindert, dass der andere Ehegatte durch das Bestreiten materiell-rechtlicher Scheidungsvoraussetzungen (Ablauf des Trennungsjahrs, Scheitern der Ehe) seine Auskunft über Versorgungsanrechte und damit das Scheidungsverfahren verzögern kann.
Quelle | BGH, Beschluss vom 30.9.2020, XII ZB 438/18
Gleichberechtigung: Ehevertrag nach Heirat kann sittenwidrig sein
Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hat jetzt entschieden: Ein Ehevertrag kann sittenwidrig sein, wenn er mehrere Monate nach der Eheschließung geschlossen wurde. Es kommt auf die Gesamtwürdigung sämtlicher Umstände an.
Das war geschehen
Ein Ehepaar heiratete im Jahr 2003 und schloss drei Monate nach Eheschließung einen Ehevertrag ab. Darin vereinbarte es Gütertrennung und schloss so den Zugewinnausgleich aus. Bei dem eigentlich gesetzlich vorgesehenen Zugewinnausgleich wird der Vermögenszuwachs hälftig geteilt, den die Eheleute während der Ehe erzielen. Sie schlossen außerdem den Versorgungsausgleich aus, also eine Teilung der während der Ehe entstandenen Anrechte auf Renten und andere Altersversorgungen. Das Ehepaar ließ sich 2019 scheiden. Das Amtsgericht (AG) hatte den Ehevertrag als wirksam angesehen und lehnte Zugewinn- und Versorgungsausgleich ab.
So sah es das OLG
Das OLG sah demgegenüber Folgendes: Die Frau hatte sich zum Wohle der Ehe in ein fremdes Land begeben und dafür eine auskömmliche Berufstätigkeit sowie eine versprochene Rente aufgegeben. In Deutschland wurde ihre Ausbildung zunächst nicht anerkannt. Folge: Der Ausschluss von Zugewinnausgleich und Versorgungsausgleich kam einseitig ausschließlich dem Ehemann zugute.
Gleichberechtigung von Mann und Frau
Das OLG betonte den Grundsatz: Die Gleichberechtigung von Mann und Frau darf durch einen Ehevertrag nicht ausgehebelt werden. Hier sei er in einer Situation vereinbart worden, in der Frau und Kind völlig abhängig vom Ehemann waren. Dieser habe sich „der prekären Situation seiner Ehefrau vollkommen verschlossen und einseitig und nicht schutzwürdig alleine seine vermögensrechtlichen Interessen für den Fall der Scheidung zu wahren gesucht“. Folge: Der Ehevertrag war sittenwidrig und unwirksam. Nun soll das AG den bisher unterlassenen Zugewinn- und Versorgungsausgleich nachholen.
Quelle | OLG Karlsruhe, Beschluss vom 10.4.2021, 5 UF 125/20
Interessenkonflikt: Erbeinsetzung eines Betreuers kann sittenwidrig sein
Setzt ein Hilfsbedürftiger kurz nach Beginn der Betreuung seine Betreuerin als Erbin ein, kann das Testament wegen Sittenwidrigkeit nichtig sein. So hat es jetzt das Oberlandesgericht (OLG Celle) entschieden.
Das war geschehen
Im Dezember 2004 erlitt ein damals 85-jähriger Mann einen schweren Schlaganfall. Neben einer Halbseitenlähmung hatte er erhebliche psychische Ausfallerscheinungen. Er war nicht orientiert, wusste nicht, dass er sich im Krankenhaus befand und musste zeitweise fixiert werden. Da er deshalb nicht in der Lage war, seine Angelegenheiten selbst zu besorgen, richtete das Amtsgericht (AG) Anfang Januar 2005 eine sog. rechtliche Betreuung ein und bestellte eine Berufsbetreuerin zur Betreuerin des Mannes, der keine Angehörigen hatte. Diese hatte u.a. die Aufgabe, die Gesundheits- und Vermögensangelegenheiten des Mannes in seinem Interesse zu regeln.
Anfang April 2005 zog der Mann aus dem Krankenhaus in eine Pflegeeinrichtung. Am 4. Mai 2005 setzte er die Betreuerin sowie eine weitere Person, die ihm von der Betreuerin für verschiedene Dienstleistungen wie Einkäufe und Spaziergänge vermittelt worden war, zu seinen Erben sein. Dieses Testament wurde im Beisein der Betreuerin von einer Notarin aufgenommen. Der Wert des Vermögens des Mannes war dort mit 350.000 Euro angegeben. Die Betreuerin verheimlichte diese Erbeinsetzung gegenüber dem AG, das die Betreuung im Dezember 2005 auf der Grundlage eines fachärztlichen Gutachtens und nach eigener Anhörung des Mannes verlängerte. Der Mann starb im April 2012. Die Betreuerin und die als weiterer Erbe eingesetzte Person teilten das Guthaben des Erblassers unter sich auf.
So entschieden die Vorinstanzen
Anfang 2014 bestellte das AG Hannover einen sog. Nachlasspfleger, der den Nachlass zugunsten der unbekannten Erben des Mannes sichern sollte. Dieser verlangte von der Betreuerin und der weiteren Person die Herausgabe der von diesen erlangten Vermögenswerte. Das Landgericht (LG) gab der Klage durch ein erstes Teilurteil im Grundsatz statt und wies die Widerklage der Beklagten ab, die die Feststellung begehrten, dass sie selbst Erben geworden seien.
Das sagt das OLG
Das OLG Celle wies die von den Beklagten hiergegen eingelegte Berufung nun zurück und stützte diese Entscheidung auf zwei Gesichtspunkte:
Erblasser nicht testierfähig
Zum einen war das OLG davon überzeugt, dass der Erblasser im Mai 2005 nicht testierfähig war. Grundsätzlich kann zwar jeder Mensch ab Vollendung des 16. Lebensjahrs wirksam ein Testament errichten. Diese Fähigkeit fehlt aber ausnahmsweise, wenn eine Person krankheitsbedingt nicht in der Lage ist, sich ein klares Urteil u.a. darüber zu bilden, welche Tragweite und Auswirkungen ihre testamentarischen Anordnungen haben, oder wenn sie nicht frei von Einflüssen Dritter nach diesem Urteil handeln kann. Eine solche Ausnahmesituation hat der Senat im vorliegenden Fall – ebenso wie das LG – nach umfangreicher Auseinandersetzung mit verschiedenen ärztlichen Berichten und Gutachten sowie weiteren Beweismitteln angenommen.
Sittenwidrigkeit der Erbeinsetzung
Zum anderen hat das OLG festgestellt, dass das Testament sittenwidrig und damit nach § 138 BGB nichtig war. Zwar gibt es keine ausdrückliche gesetzliche Vorschrift (anders als im Heimrecht), die es Betreuern untersagt, neben der vereinbarten Vergütung Geschenke entgegenzunehmen, soweit diese über geringwertige Aufmerksamkeiten hinausgehen. Das OLG folgerte die Sittenwidrigkeit der Erbeinsetzung aber daraus, dass die Betreuerin die von Einsamkeit und Hilflosigkeit geprägte Situation des Erblassers zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt habe.
Erbeinsetzung verschwiegen
Denn das Testament wurde kurz nach der Krankenhausentlassung errichtet. Der Erblasser kannte die Betreuerin erst kurze Zeit. Im damaligen Zeitraum hatte er noch gegenüber der Betreuungsrichterin des AG angegeben, nichts von einer Betreuung zu wissen. Trotz der erheblichen Erkrankung hatte die Betreuerin keinen ärztlichen Rat eingeholt, ob er überhaupt testierfähig war. Sie selbst hatte die Notarin mit der Aufnahme des Testaments beauftragt und war – ohne zwingenden Grund – bei der gesamten Testamentsaufnahme anwesend. Dabei sei ihr bewusst gewesen, dass der Erblasser dieses notarielle Testament später aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen nicht mehr durch ein eigenes handschriftliches Testament habe ersetzen können. Gegenüber dem AG habe sie u.a. die Erbeinsetzung verschwiegen, sodass das Gericht mögliche Interessenkonflikte nicht prüfen konnte.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Quelle | OLG Celle, Urteil vom 7.1.2021, 6 U 22/20, PM Nr. vom 9.4.2021
Nachlassgericht: Erlass eines quotenlosen Erbscheins: Wer muss zustimmen?
Die Frage, wer bei der Beantragung eines quotenlosen Erbscheins zustimmen muss, ist umstritten. Die zwei bekanntesten obergerichtlichen Entscheidungen hierzu liegen diametral auseinander. Während das Oberlandesgericht (OLG) München fordert, dass alle in Betracht kommenden Erben auf die Aufnahme der Erbquoten im Erbschein verzichten müssen, lässt es das OLG Düsseldorf genügen, dass nur die Antragsteller auf die Angaben der Quoten verzichten. Jetzt ist das OLG Bremen dem OLG München beigesprungen.
Im Fall des OLG Bremen hatte ein Beteiligter den Erlass eines Erbscheins ohne Erbteilsquoten beantragt, weil diese erst nach Aufklärung der Wertverhältnisse des Nachlasses sicher festgestellt werden könnten. Die hierzu angehörte andere Beteiligte hatte dem jedoch widersprochen, weil die Auslegung des Testaments ergebe, dass sie Alleinerbin geworden sei. Das Nachlassgericht hatte aufgrund des Widerspruchs verfügt, ein gemeinschaftlicher quotenloser Erbschein komme nicht in Betracht. Das OLG Bremen sah dies genauso.
Quelle | OLG Bremen, Urteil vom 28.10.2020, 5 W 15/20
Mietrecht und WEG
BGH-Entscheidung: Erste Musterfeststellungsklage in Mietsachen gescheitert
Modernisierungsmaßnahmen, die dem Mieter bis 31.12.18 angekündigt werden, rechtfertigen eine Mieterhöhung nach altem, bis zum 31.12.2018 geltenden Recht, auch wenn ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Ankündigung und der Ausführung der Arbeiten fehlt. So hat es jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.
Um sich die höhere Modernisierungsmiete nach altem Recht zu erhalten, kündigte die Musterbeklagte, eine große Münchener Wohnungsgesellschaft, den Mietern noch Ende Dezember 2018 Modernisierungsmaßnahmen an, die in mehreren Bauabschnitten von Dezember 2019 bis Juni 2023 durchgeführt werden sollten. Denn während bis zum 31.12.18 die Erhöhung der jährlichen Miete um 11 Prozent der für die Modernisierung aufgewendeten Kosten möglich war, kann seit dem 1.1.19 die Miete um höchstens 8 Prozent erhöht werden. Zudem sieht das neue Recht eine Kappungsgrenze vor. Stichtag für die Anwendung der 11 Prozent-Erhöhung ist der Zugang der Modernisierungsmitteilung bis zum 31.12.18.
Der Mieterverein München wollte diese „Trickserei“ nicht hinnehmen und hat vor dem Oberlandesgericht (OLG) München Musterklage auf Feststellung erhoben, dass die angekündigte Mieterhöhung nicht nach altem Recht erfolgen könne. Das OLG hatte der Klage noch stattgegeben.
Doch der BGH hat zugunsten des Vermieters entschieden. Er hob das Urteil auf und wies die Klage ab. Der Vermieter habe sich an die gesetzlichen Voraussetzungen gehalten. Diese setzen keinen engen zeitlichen Zusammenhang zwischen einer Modernisierungsankündigung und dem Ausführungsbeginn voraus. Das Verhalten des Vermieters sei auch dann nicht rechtsmissbräuchlich, wenn der Beweggrund für die Wahl des Zeitpunkts der Modernisierungsankündigungen – kurz vor dem Jahresende 2018 – in der Nutzung der Übergangsvorschrift und der Sicherung der Anwendbarkeit des bis zum 31.12.18 geltenden, für den Vermieter deutlich günstigeren Rechts, gelegen haben sollte.
Folge: Die Entscheidung bedeutet eine saftige Mieterhöhung für die betroffenen Mieter.
Quelle | BGH, Urteil vom 18.3.2021, VIII ZR 305/19
Betriebskosten: Vermieter können Kosten für Rauchmelder auf Mieter umlegen
Das Landgericht (LG) München I hat entschieden: Die Umlage von „sonstigen Betriebskosten“, die nach Mietvertragsabschluss neu entstanden und im Mietvertrag nicht im Einzelnen benannt sind (hier: Wartungskosten für Rauchwarnmelder), erfordert in jedem Fall eine entsprechende Erklärung des Vermieters gegenüber dem Mieter, in welcher der Grund für die Umlage bezeichnet und erläutert wird. Kurzum: Kosten für Rauchmelder sind danach umlagefähig, wenn der Vermieter sie ankündigt.
Zwischen dem Kläger als Eigentümer und Vermieter und der Beklagten besteht aufgrund schriftlichen Mietvertrags seit dem Jahr 2001 ein Mietverhältnis über eine Wohnung in München. Darin wurden Vorauszahlungen für Betriebskosten vereinbart.
Der Kläger hatte über die Betriebskosten für das Wirtschaftsjahr 2018 abgerechnet. Die Abrechnung wies insgesamt einen Nachzahlungsbetrag von rund 300 Euro aus, den er zunächst vor dem Amtsgericht (AG) München einklagte. Darin enthalten waren 16,35 Euro für „Rauchwarnmelder“. Im Mietvertrag wird diese Position bei der Auflistung der einzelnen Betriebskostenarten jedoch nicht namentlich genannt. Die beklagte Mieterin vertrat die Auffassung, dass die Kosten für die Wartung der Rauchwarnmelder mangels vertraglicher Vereinbarung nicht umgelegt werden können. Das AG München hat dem Kläger einen Betrag zugesprochen, worin der genannte Betrag von 16,35 Euro betreffend die Position „Rauchmelder“ enthalten war.
Das LG München I sieht dies jedoch anders und hat die Klage in diesem Punkt abgewiesen: Grundsätzlich können danach Betriebskosten nur auf den Mieter umgelegt werden, wenn dies vorher im Einzelnen vereinbart wurde. Da dem Mieter deutlich gemacht werden muss, welche Betriebskosten auf ihn übergewälzt werden, ist es erforderlich, auch die „sonstigen Betriebskosten“ im Einzelnen zu nennen.
Da es sich im vorliegenden Fall jedoch sowohl um eine von der Mieterin zu duldende und zudem gesetzlich vorgeschriebene Modernisierungsmaßnahme handele, als auch im streitgegenständlichen Mietvertrag eine Öffnungsklausel enthalten sei, sind die Wartungskosten für die Rauchwarnmelder trotz fehlender Benennung im Mietvertrag als Betriebskosten ausnahmsweise umlagefähig, so das LG.
Allerdings scheitere die Umlagefähigkeit der Wartungskosten hier letztlich an der fehlenden Erklärung des Vermieters. Folge: Die Kosten für die Wartung von Rauchmeldern können grundsätzlich auf den Mieter umgelegt werden, dies bedarf jedoch einer vorherigen ausdrücklichen Erklärung des Vermieters.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Quelle | LG München I, Urteil vom 15.4.2021, 31 S 6492/20, PM Nr. 9/21 vom 16.4.2021
Wohnraummietvertrag: Nichtbeheizen rechtfertigt ordentliche Kündigung
Heizt der Mieter die Wohnung nicht, kann dies Schäden an der Mietsache hervorrufen. Sein Verhalten rechtfertigt eine ordentliche Kündigung. So hat es jetzt das Landgericht (LG) Hannover entschieden.
Der Vermieter kündigte den Wohnraummietvertrag ordentlich fristgemäß, nachdem der Mieter seinen Direktvertrag gegenüber dem Gasversorger nicht mehr bezahlte und dieser den Gaszähler ausgebaut hatte. Die Wohnung war dann die gesamte Heizperiode unbeheizt und gefährdete die Mietsache. Auf Abmahnungen des Vermieters reagierte der Mieter nicht.
Nach Ansicht des LG stellt dies eine erhebliche Pflichtverletzung des Mieters dar, die nach vorheriger Abmahnung eine ordentliche Kündigung rechtfertigt. Ähnlich hatte das auch früher schon das Landgericht (LG) Hagen gesehen.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob es zu Schäden durch Schimmelbildung oder Feuchtigkeit gekommen ist. Entscheidend ist, dass das Nichtbeheizen der Wohnung geeignet ist, solche Schäden an der Mietsache hervorzurufen.
Quelle | LG Hannover, Urteil vom 10.4.2021, 7 T 15/21; LG Hagen, Urteil vom 19.12.2007, 10 S 163/ 07
Verbraucherrecht
Unberechtigte Gebühren: Keine Kontoführungskosten für Inkassounternehmen
Inkassounternehmen sind nicht berechtigt, den Forderungsschuldnern ihrer Auftraggeber interne Kontoführungskosten in Rechnung zu stellen. Dies gilt sowohl im Zusammenhang mit der Geltendmachung titulierter als auch nicht titulierter Forderungen. So hat es jetzt das Verwaltungsgericht (VG) Neustadt an der Weinstraße entschieden.
Ein Inkassounternehmen, das pro Jahr mehrere hunderttausend Verfahren bearbeitet, hatte den Schuldnern „Kontoführungskosten“ für das Führen eines internen „Schuldnerkontos“ berechnet. Dies, so das VG, sei interne Büroorganisation und damit die eigene Sache des Inkassounternehmens. Es gebe keine Rechtsgrundlage, hierfür Gebühren zu erheben.
Quelle | VG Neustadt, Urteil vom 10.3.2021, 3 K 802/20.NW
Bußgeld: Was ist ein öffentlicher Weg?
Darf man mit einem Mountainbike im Wald fahren? Mit dieser Frage hat sich jetzt das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg auseinandergesetzt.
Ein Mann war in Niedersachsen mit seinem Mountainbike in einem Waldgebiet unterwegs. Die Stadt erließ gegen ihn einen Bußgeldbescheid über 150 Euro mit der Begründung, der Mann sei außerhalb öffentlicher Wege gefahren.
Nach dem Niedersächsischen Waldgesetz darf man mit Fahrrädern auch auf sogenannten „tatsächlichen öffentlichen Wegen“ fahren. Das sind solche Wege, die mit Zustimmung oder Duldung des Grundeigentümers tatsächlich für den öffentlichen Verkehr genutzt werden, wie Wander- Reit- und Freizeitwege, nicht aber z.B. Fuß- und Pirschpfadwege. Auch die von „Downhill-Bikern“ eigenständig geschaffenen Wege gehören nicht dazu. Dort, so steht es im Bußgeldbescheid, sei das Fahrradfahren verboten. Die Schädigung des Waldes durch eine solche Nutzung – Erosion und Verletzung von Bäumen – sei deutlich erkennbar. Der Mann habe durch seine illegale Fahrt während der Brut- und Setzzeit auch eine hochtragende Ricke aufgeschreckt.
Der Mann wollte den Bußgeldbescheid nicht akzeptieren und legte Einspruch ein. Vor dem Amtsgericht (AG) Bad Iburg hatte er keinen Erfolg. Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass der Mann auf einem Trampelpfad und nicht auf einem tatsächlich öffentlichen Weg unterwegs gewesen sei.
Der Mann begehrte die Zulassung der Rechtsbeschwerde beim OLG. Er argumentierte, er sei davon ausgegangen, den Weg nutzen zu dürfen. Das OLG wies den Antrag zurück. Das AG habe rechtsfehlerfrei festgestellt, dass der Grundstückseigentümer der öffentlichen Nutzung des Wegs nicht zugestimmt habe und dass dies für den Mann auch erkennbar gewesen sei. Es sei auch von dem Grundstückseigentümer nicht zu fordern, dass er Verbotsschilder aufstelle, zumal alle tatsächlich öffentlichen Wege durch Schilder freigegeben seien.
Quelle | OLG Oldenburg, Beschluss vom 26.1.2021, 2 Ss OWi 25/21, PM Nr. 11/21 vom 15.4.2021
Vermittlungstätigkeit: Makler müssen sich beeilen …
Eine Maklercourtage ist nicht geschuldet, wenn zwischen der Tätigkeit des Maklers und dem Kaufvertragsschluss 14 Monate liegen und der Käufer die Immobile zwischenzeitlich gemietet hat.
Das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken hat entschieden: Der Käufer eines Hauses schuldet keinen Maklercourtage, wenn er auf das Objekt zwar zunächst durch den Makler aufmerksam gemacht worden ist, der Kaufvertrag dann aber im Notartermin platzte, er daraufhin die Immobilie anmietet und über ein Jahr später dann doch erwirbt.
Der Makler bot eine Immobile zum Verkauf an, bei der noch eine Grundstücksaufteilung vor dem Kauf vorgenommen werden musste. Der Käufer wurde durch den Makler auf das Haus aufmerksam gemacht. Er entschloss sich, das Haus zu erwerben. Der Notartermin platzte, weil der beurkundende Notar auf Probleme bei der Aufteilung des Grundstücks hinwies. Der Käufer mietete die Immobile hiernach an. Nach Ablauf von 14 Monaten erwarb der Käufer die Immobile von den Verkäufern. Der Makler forderte mit seiner Klage die Maklercourtage von über 7.000 Euro.
Das Landgericht (LG) Landau hatte die Klage bereits abgewiesen. Das OLG hat diese Entscheidung bestätigt. Begründung: Dem Makler stehe eine Vergütung nur zu, wenn der beabsichtigte Vertrag tatsächlich aufgrund seiner Vermittlungstätigkeit zustande komme. Dies müsse der Makler nachweisen. Erleichterungen bei diesem Nachweis seien anzunehmen, wenn der Makler die Gelegenheit zum Vertragsschluss nachgewiesen habe und seiner Tätigkeit der Abschluss des Hauptvertrags in angemessenem Zeitabstand folge. Dann werde zugunsten des Maklers vermutet, dass der Vertrag aufgrund der Leistungen des Maklers zustande gekommen sei. Der hier zwischen Nachweisleistung und dem Vertragsschluss liegende Zeitraum lasse eine solche Vermutung zugunsten des Klägers nicht mehr zu. Zwischen Übersendung des Immobilienexposés und dem Abschluss des Kaufvertrags lagen ca. 14 Monate. Der Käufer habe seine Erwerbsabsicht vorübergehend auch vollständig aufgegeben, da er sich nach der Abstandnahme vom Kaufvertrag dazu entschlossen habe, das streitgegenständliche Objekt anzumieten.
Weiter habe der Käufer zunächst ein erneutes Kaufangebot der Verkäufer abgelehnt und auch Besichtigungen des Anwesens durch potenzielle Erwerber erdulden müssen. Auch sei die Kündigung des Mietverhältnisses durch den Verkäufer erklärt worden. Bei Berücksichtigung dieser Umstände könne der Erwerb der Immobilie mehr als ein Jahr nach dem ersten Notartermin nicht mehr im Zusammenhang mit der Leistung des Maklers gesehen werden.
Die Revision hat das OLG nicht zugelassen.
Quelle | OLG Zweibrücken, Beschluss vom 5.10.2020, 5 U 42/20, PM vom 7.4.2021
Verkehrsrecht
Nutzungsausfall: Trotz abgelaufener Hauptuntersuchung sind Mietwagenkosten zu erstatten
Der Schädiger muss Mietwagenkosten erstatten, auch wenn das verunfallte Fahrzeug bereits vor dem Unfall einen Riss in der Frontscheibe aufwies und die HU-Plakette abgelaufen war. Das hat das Landgericht (LG) Stuttgart entschieden und damit ein Urteil des Amtsgerichts (AG) Stuttgart korrigiert.
Die Begründung des LG: Die Benutzung des verunfallten Fahrzeugs vor dem Unfall und die gedachte weitere Nutzung nach dem Unfall stelle zwar evtl. eine Ordnungswidrigkeit dar. Dennoch hatte der Geschädigte ein Fahrzeug, das er auch genutzt hat.
Wie lange der HU-Termin schon überzogen war, ist nicht bekannt. Ein solches Fahrzeug würde aber bei einer Kontrolle nicht sofort festgesetzt, wenn die HU nicht bereits jahrelang überfällig gewesen ist. So war für das LG entscheidend, dass der Geschädigte sowohl die Nutzungsmöglichkeit und auch den Nutzungswillen hatte.
Quelle | LG Stuttgart, Urteil vom 4.3.2021, 5 S 195/20
Schadenersatz: So können sich Reparaturverzögerungen auf den Nutzungsausfallschaden auswirken
Zu Störungen im Reparaturablauf nach einem Unfall kann es aus verschiedenen Gründen kommen. Unter dem Blickwinkel des Nutzungsausfallschadens können sie zulasten des Schädigers gehen, andererseits aber auch vom Geschädigten zu verantworten sein. Worauf es ankommt und welche Seite wofür darlegungs- und beweispflichtig ist, hat jetzt das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf geklärt.
Zwischen dem Unfalltag und dem Tag der Fahrzeugrückgabe lagen 190 Tage. Die beklagte Versicherung sah sich nur für 31 Tage in der Ersatzpflicht. Die in diesem Zeitraum angefallenen Mietwagenkosten hat sie reguliert, jeden weiteren Ersatz aber abgelehnt. Das OLG Düsseldorf hat eine „abstrakte“ Nutzungsausfallentschädigung für weitere 104 Tage Zug um Zug gegen Abtretung eines (möglichen) Ersatzanspruchs gegen die Werkstatt zugesprochen. Den weitergehenden Anspruch hat es wegen Verstoß gegen die sog. Schadensminderungspflicht zurückgewiesen (hier: Verzögerungen bei der Erteilung des Gutachter- und des Werkstattauftrags).
Ohne Erfolg ist der Einwand der Beklagten geblieben, die Klägerin habe für den streitigen Ausfallzeitraum schon deshalb keinen Ersatzanspruch, weil sie auf einen „Zweitwagen“ habe zurückgreifen können. Nach dem unwiderlegten Vortrag der Klägerin handelte es sich um den Pkw ihres Sohnes und damit um eine den Schädiger nicht entlastende freiwillige Leistung eines Dritten. Damit stellte sich dem OLG die Frage, zu wessen Lasten die Verzögerung der Reparaturarbeiten geht. Die Werkstatt – keine Markenwerkstatt – begründet sie mit Lieferschwierigkeiten bei der Beschaffung eines Airbag-Moduls für die Beifahrerseite.
Was ein Geschädigter in dieser Situation nicht tun muss, also lassen darf, macht das OLG u. a. deutlich:
- Den Geschädigten trifft kein Auswahlverschulden, wenn er eine freie Werkstatt beauftragt.
- Er begeht keine sog. Obliegenheitsverletzung, wenn er die Reparatur nicht überwacht.
- Er muss die Ausfallzeit nicht durch eine Teilreparatur verkürzen, also z. B. den Pkw vorübergehend ohne Beifahrerairbag weiternutzen.
Das OLG hält schließlich noch fest: Der Klägerin wird nur eine sog. sekundäre Darlegungslast auferlegt, der sie – nicht zuletzt durch Vorlage des Reparaturablaufplans – hier genügt hatte.
Beachten Sie | Den gegnerischen Versicherer bei längeren Verzögerungen zu informieren, ist ratsam, zumal bei Inanspruchnahme eines Mietwagens.
Quelle | OLG Düsseldorf, Urteil vom 9.3.2021, I-1 U 77/20
Unfallhaftung: Wenn der Notfallbremsassistent ohne Not bremst
Löst sich auf der Autobahn unverschuldet während freier Fahrt der Notfallbremsassistent eines vorausfahrenden Fahrzeugs und fährt der nachfolgende LKW ohne Einhalten des Sicherheitsabstands von mindestens 50 Metern auf das abrupt abgebremste Fahrzeug auf, überwiegt der Haftungsanteil des nachfolgenden LKW.
Die unbegründete und erhebliche Unterschreitung des Sicherheitsabstands ist auf ein schuldhaftes Verhalten zurückzuführen, während das vorausfahrende Fahrzeug aufgrund eines technischen Versagens abgebremst wurde. Dies rechtfertige eine Haftungsverteilung von 2/3 zulasten des LKW-Fahrers, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main.
Die Klägerin nahm die Beklagten auf Schadenersatz nach einem Verkehrsunfall auf der A5 Richtung Kassel/Hannover in Anspruch. Sie fuhr vor dem Beklagtenfahrzeug, einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 Tonnen. Während ihrer Fahrt löste sich der Notfallbremsassistent. Der Beklagte konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem klägerischen Fahrzeug.
Das Landgericht (LG) hatte der Klägerin 1/3 des geltend gemachten Schadens zugesprochen. Ihre hiergegen gerichtete Berufung hatte zum Teil Erfolg. Das OLG sprach der Klägerin nun 2/3 ihres Schadens zu.
Bei dem erforderlichen Haftungsausgleich zwischen den Beteiligten sei, so das OLG, zu berücksichtigen, dass der Unfall durch das Beklagtenfahrzeug mitverursacht worden sei. Dieses habe aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstands zum vorausfahrenden klägerischen Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen können. Angesichts der Größe des Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen hätte auf Autobahnen zu vorausfahrenden Fahrzeugen ein Mindestabstand von 50 Metern eingehalten werden müssen, wenn die Geschwindigkeit mehr als 50 km/h betrage. Sachverständig geklärt war im vorliegenden Fall, dass dieser Sicherheitsabstand trotz der gefahrenen Geschwindigkeit nicht eingehalten worden war.
Die Klägerin müsse sich aber als Verursachungsbeitrag vorwerfen lassen, dass sie ihr Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund auf freier Strecke abrupt abgebremst habe.
Die gebotene Abwägung dieser beiderseitigen Verursachungsbeiträge führe zu einer Haftungsverteilung von 2/3 zulasten der Beklagten und 1/3 zulasten der Klägerin. Hinsichtlich des LKW-Fahrers sei von einem Verschulden auszugehen, da der erforderliche Sicherheitsabstand ohne zwingende Gründe um etwa 30 Prozent unterschritten worden sei. Das abrupte Abbremsen der Klägerin sei dagegen unstreitig auf das Versagen der technischen Einrichtung ihres Kraftfahrzeugs zurückzuführen, sodass sie kein Verschulden treffe.
Quelle | OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 9.3.2021, 23 U 120/20
Frontalaufprall: Wann ist ein Unfall ein Unfall?
Ein Unfall im Sinne der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Kraftfahrtversicherung liegt auch vor, wenn der Schaden durch den Versicherungsnehmer freiwillig herbeigeführt wurde. Ob dies vorsätzlich in Suizidabsicht geschah, was dazu führen würde, dass der Versicherer von seiner Leistung frei würde, kann nur aufgrund einer Gesamtwürdigung aller Indizien festgestellt werden. Die Beweislast hierfür trägt der Versicherer. Das hat jetzt das Oberlandesgericht (OLG) Dresden klargestellt.
Was war geschehen?
Der Versicherungsnehmer prallte mit seinem Kfz frontal gegen einen Straßenbaum, nachdem er beim Anfahren das Fahrzeug stark beschleunigt hatte. Das Fahrzeug erlitt hierbei einen Totalschaden. Der Versicherer hat eine Regulierung des Schadens abgelehnt, weil der Versicherungsnehmer den Unfall vorsätzlich in Suizidabsicht herbeigeführt habe. Damit greife die vereinbarte Ausschlussklausel.
Das Landgericht (LG) hat ein unfallanalytisches Gutachten eingeholt. Danach lasse sich keine Suizidabsicht beweisen. Gleichwohl hat es die Klage abgewiesen. Es könne dahinstehen, ob der Kläger den Unfall vorsätzlich herbeigeführt habe. Sein Verhalten stelle sich jedenfalls deswegen als grob fahrlässig dar, weil er es versäumt habe, den durch die Beschleunigung ausgelösten Driftvorgang dadurch abzuwenden, dass er den Fuß vom Gaspedal genommen hätte. Dies stelle sich als so schwerwiegendes Versäumnis dar, dass hier ausnahmsweise eine Leistungskürzung auf Null gerechtfertigt sei.
So sieht es das OLG
Das OLG Dresden hat auf die Berufung des Versicherungsnehmers das Urteil geändert und den Versicherer antragsgemäß verurteilt. Es stellt klar: Es handelt sich bei dem o. g. Ereignis um einen „Unfall“ im Sinne des Versicherungsrechts. Ein solcher liege auch vor, wenn der Schadensfall vorsätzlich herbeigeführt worden sei. Für das Vorliegen eines Unfalls komme es allein darauf an, dass der Schaden durch eine von außen plötzlich einwirkende mechanische Kraft herbeigeführt werde. Dies sei hier durch den Zusammenprall mit dem Straßenbaum der Fall.
Ein Haftungsausschluss wegen einer grob fahrlässigen Herbeiführung des Unfalls kommt nach den eindeutigen Versicherungsvereinbarungen nicht in Betracht. Dort heißt es nämlich ausdrücklich: „Wir verzichten in der Fahrzeugversicherung auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Schadens.“ Gegen die Wirksamkeit dieser Verzichtsklausel hatte das OLG keine Bedenken.
Quelle | OLG Dresden, Urteil vom 10.11.2020, 4 U 1106/20
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
Vertragsgestaltung: Behandlung von Ehegatten-Arbeitsverhältnissen
Bei Ehegatten-Arbeitsverhältnissen schauen die Finanzämter regelmäßig ganz genau hin. Denn während Vertragsgestaltungen zwischen fremden Dritten von Interessengegensätzen geprägt sind, fehlen diese bei Verträgen zwischen nahen Angehörigen. Somit steht zumindest die Vermutung im Raum, dass die Vereinbarung nur aus Steuerersparnisgründen geschlossen wurde. Grund genug, auf zwei aktuelle Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (BFH) zu dieser Thematik hinzuweisen.
Nachweise: Stundenzettel und Aufzeichnungen
Ein Ehegatten-Arbeitsverhältnis ist nicht allein deshalb steuerlich unwirksam, weil der Arbeitgeber keine Aufzeichnungen (z. B. Stundenzettel) zur Arbeitszeit des angestellten Ehegatten geführt hat. Stundenzettel dienen „nur“ Beweiszwecken und sind für die Anerkennung eines Arbeitsverhältnisses zwischen nahen Angehörigen nicht zwingend erforderlich.
Beachten Sie | Die Entscheidung ist richtig einzuordnen. Der BFH hat nämlich den strengen Nachweisanforderungen, die für ein Ehegatten-Arbeitsverhältnis gelten, keine Absage erteilt. Erforderlich (aber auch ausreichend) ist das, was auch bei Arbeitsverhältnissen zwischen fremden Dritten üblich ist.
Wertguthabenvereinbarung: Auf Wahlfreiheit kommt es an
Wird im Zuge eines Arbeitsverhältnisses zusätzlich eine Wertguthabenvereinbarung im Sinne des Sozialgesetzbuchs (SGB IV) abgeschlossen, muss für diese – gesondert – ein Fremdvergleich erfolgen.
Bei der Gesamtwürdigung ist vor allem entscheidend, ob die Vertragschancen und -risiken fremdüblich verteilt sind. Eine einseitige Verteilung zulasten des Arbeitgeber-Ehegatten ist regelmäßig anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer-Ehegatte unbegrenzt Wertguthaben ansparen sowie Dauer, Zeitpunkt und Häufigkeit der Freistellungsphasen nahezu beliebig wählen kann.
Quelle | BFH, Urteil vom 18.11.2020, VI R 28/18; BFH, Urteil vom 28.10.2020, X R 1/19
Gesetzgebung: Steuerfreie Corona-Prämie bis 31.3.2022 verlängert
Mit der Corona-Prämie können Steuern und Sozialversicherungsbeiträge gespart werden. Aktuell hat der Gesetzgeber die Zahlungsmöglichkeit erneut verlängert – und zwar bis zum 31.3.22.
Nach dem Einkommensteuergesetz (§ 3 Nr. 11a EstG) sind steuerfrei: „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der Zeit vom 1.3.20 bis zum 30.6.21 aufgrund der Coronakrise an seine Arbeitnehmer in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewährte Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 Euro.“
Durch das Jahressteuergesetz 2020 wurde die Befristung der Corona-Prämie bereits vom 31.12.20 bis zum 30.6.21 verlängert. Nunmehr erfolgte durch das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzStEntModG) eine erneute Verlängerung bis zum 31.3.22.
Beachten Sie | Der Höchstbetrag je Arbeitnehmer wurde nicht geändert. Die Fristverlängerung bewirkt also nicht, dass z. B. im ersten Quartal 2022 nochmals 1.500 Euro steuerfrei zusätzlich zu einem z. B. in 2021 gezahlten Betrag von 1.500 Euro gezahlt werden können.
Quelle | AbzStEntModG, BR-Drs. 353/21 (B) vom 28.5.2021
Berechnung der Verzugszinsen
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 beträgt -0,88 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent
Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).
Übersicht / Basiszinssätze
| Zeitraum | Zinssatz |
|---|---|
| 01.07.2020 bis 31.12.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2020 bis 30.06.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2019 bis 31.12.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2019 bis 30.06.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2018 bis 31.12.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2018 bis 30.06.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2017 bis 31.12.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2017 bis 30.06.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2016 bis 31.12.2016 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2016 bis 30.06.2016 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2015 bis 31.12.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.01.2015 bis 30.06.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2014 bis 31.12.2014 | -0,73 Prozent |
| 01.01.2014 bis 30.06.2014 | -0,63 Prozent |
| 01.07.2013 bis 31.12.2013 | -0,38 Prozent |
| 01.01.2013 bis 30.06.2013 | -0,13 Prozent |
| 01.07.2012 bis 31.12.2012 | 0,12 Prozent |
| 01.01.2012 bis 30.06.2012 | 0,12 Prozent |
| 01.07.2011 bis 31.12.2011 | 0,37 Prozent |
| 01.01.2011 bis 30.06.2011 | 0,12 Prozent |
| 01.07 2010 bis 31.12.2010 | 0,12 Prozent |
| 01.01.2010 bis 30.06.2010 | 0,12 Prozent |
| 01.07 2009 bis 31.12.2009 | 0,12 Prozent |
| 01.01.2009 bis 30.06.2009 | 1,62 Prozent |
| 01.07.2008 bis 31.12.2008 | 3,19 Prozent |
| 01.01.2008 bis 30.06.2008 | 3,32 Prozent |
| 01.07.2007 bis 31.12.2007 | 3,19 Prozent |
| 01.01.2007 bis 30.06.2007 | 2,70 Prozent |