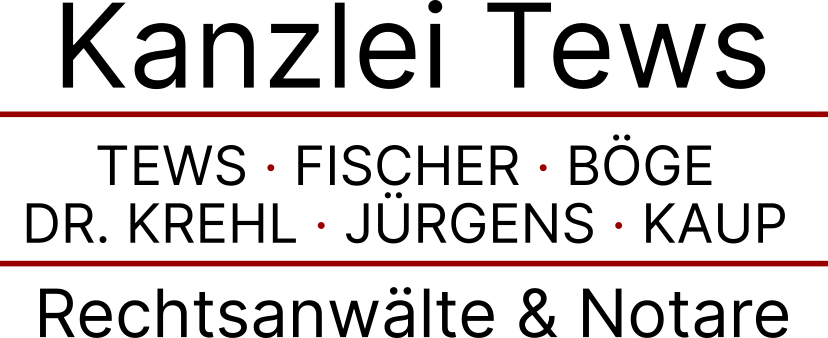März 2023
- März 2023
Arbeitsrecht
Altersdiskriminierung: Auch Schiedsrichter sind geschützt
Einem Schiedsrichter steht eine Entschädigung wegen Altersdiskriminierung zu, wenn er aufgrund des Erreichens der Altersgrenze von 47 Jahren nicht mehr in die Schiedsrichterliste des Deutschen Fußballbundes (DFB) aufgenommen worden ist. Das hat das Landgericht (LG) Frankfurt am Main aktuell entschieden.
DFB: Regularisch keine Altersgrenze festgelegt
Der DFB hat die Hoheit über den Arbeitsmarkt und den Einsatz von Schiedsrichtern im deutschen Fußball (sog. „Ein-Platz-Prinzip“). In seinen Regularien ist eine Altersgrenze für die Aufnahme in die Schiedsrichterlisten im Profifußball nicht vorgesehen. Jedoch scheiden Elite-Schiedsrichter regelmäßig im Alter von 47 Jahren aus. Davon wurde in den letzten fast vier Jahrzehnten keine Ausnahme gemacht.
Bundesliga-Schiedsrichter mit 47 Jahren „ausgemustert“
Der Kläger war seit vielen Jahren Schiedsrichter im Auftrag des DFB. Seit 2004 leitete er Spiele der ersten Bundesliga. Nachdem der Kläger 47 Jahre alt geworden war, nahm ihn der DFB ab der Saison 2021/2022 nicht mehr in seine Schiedsrichterliste auf. Vor dem LG hat der Kläger vom DFB eine Entschädigung wegen Altersdiskriminierung und den potenziellen Verdienstausfall für die Saison 2021/2022 verlangt sowie die Feststellung, dass der DFB auch künftige Schäden (z.B. Verdienstausfall) ersetzen müsse.
Landgericht: Altersdiskriminierung liegt vor
Das LG hat dem Kläger jetzt eine Entschädigung von 48.500 Euro wegen einer Diskriminierung aufgrund seines Alters nach dem sog. Antidiskriminierungsgesetz zugesprochen. Für diesen Entschädigungsanspruch sei es ausreichend, wenn das Alter mitursächlich für die Beendigung der Schiedsrichterlaufbahn war. Ob auch andere Gründe eine Rolle spielten, sei rechtlich nicht maßgeblich.
Praktizierte Altersgrenze…
Wenngleich in den Regelwerken des DFB eine Altersgrenze für Schiedsrichter nicht schriftlich fixiert sei, bestehe aber tatsächlich eine praktizierte Altersgrenze von 47 Jahren. Denn die Bewerber würden ab diesem Lebensjahr nahezu ausnahmslos nicht mehr berücksichtigt und der DFB habe die Bedeutung dieses Alters für das Ende einer Schiedsrichtertätigkeit auch öffentlich bekundet.
… ist willkürlich
Es sei im Ergebnis willkürlich und daher nach den Regeln des Antidiskriminierungsgesetzes nicht gerechtfertigt, auf eine feste Altersgrenze von 47 Jahren abzustellen. Zwar habe das Alter aus biologischen Gründen eine statistische Relevanz für die Eignung als Schiedsrichter, weil mit ihm die Leistungsfähigkeit nachlässt und das Verletzungsrisiko steige. Warum gerade das Alter von 47 Jahren für die Leistungsfähigkeit eines Elite-Schiedsrichters ausschlaggebend sein soll, wurde nicht dargelegt, etwa durch einen wissenschaftlichen Nachweis oder einen näher begründeten Erfahrungswert. Es sei nicht ersichtlich, weshalb die individuelle Tauglichkeit der relativ geringen Anzahl von Bundesligaschiedsrichtern nicht in einem an Leistungskriterien orientierten transparenten Bewerbungsverfahren festgestellt werden könne. Adäquate und gegebenenfalls wiederholte Leistungstests und -nachweise seien gegenüber einer starren Altersgrenze vorzugswürdig.
Entschädigung für Schiedsrichter
Für die Höhe der Entschädigung war nach dem LG u. a. maßgeblich, dass das Antidiskriminierungsgesetz Sanktionscharakter hat. Die Benachteiligung des Klägers wiege schwer, weil sie von dem wirtschaftsstarken und eine Monopolstellung innehabenden Beklagten bewusst und ohne Rechtfertigungsansatz erfolgt sei.
Jedoch kein Ersatz von Verdienstausfall
Ohne Erfolg blieb jedoch die Forderung des Klägers auf Ersatz von materiellen Schäden, insbesondere auf Zahlung von Verdienstausfall. Insoweit wurde seine Klage abgewiesen. Der Kläger habe nicht dargetan, dass er ohne die Altersgrenze tatsächlich bei der Listenaufstellung berücksichtigt worden wäre. Dafür hätte er nicht nur erklären und unter Umständen beweisen müssen, dass er nicht nur für die Stelle geeignet, sondern vielmehr der „bestgeeignetste“ Bewerber war. Diesen Nachweis habe der Kläger nicht erbracht.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es kann mit der Berufung zum Oberlandesgericht (OLG) angefochten werden.
Quelle | LG Frankfurt am Main, Urteil vom 25.1.2023, 2-16 O 22/21
Ausgestreckter Mittelfinger: Außerordentliche Kündigung? Auf die Umstände kommt es an!
Die fotografisch festgehaltene Geste eines Flugzeugkapitäns, der am Ende des letzten regulären Flugeinsatzes an der von seinem Arbeitgeber geschlossenen Station nach Landung und Räumung des Flugzeugs mit seiner Crew gemeinsam den ausgestreckten Mittelfinger in Richtung Kamera hält, kann einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung begründen. Das entschied das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf.
Das LAG: So ist es jedenfalls, wenn diese Geste nachweislich gegen den Arbeitgeber gerichtet und damit beleidigend gemeint ist. Ist die Geste hingegen unwiderlegt als ein symbolisches Ausstrecken des Mittelfingers in Richtung „Corona“ als dem Grund für die Schließung der Flugzeugbasis und damit den Verlust der Arbeitsplätze gemeint, begründet das damit lediglich noch vorliegende unangemessene Verhalten keine außerordentliche Kündigung. Das gilt erst recht, wenn sich in der Firmenzentrale bekanntermaßen ein großes Wand-Bild mit einer beide Mittelfinger ausstreckenden Seniorin als Kunstobjekt befindet und mithin der Arbeitgeber selbst gegenüber derlei Gesten ein entspanntes Verhältnis pflegt.
Quelle | LAG Düsseldorf, Urteil vom 5.4.2022, 3 Sa 364/21
Fristlose Kündigung: Krankgeschrieben an Party teilgenommen
Meldet sich eine Arbeitnehmerin bei ihrem Arbeitgeber für zwei Tage krank und nimmt an einer „Wild Night Ibiza Party“ teil, ist von einer vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit auszugehen. Eine fristlose Kündigung kann dann laut dem Arbeitsgericht (ArbG) Siegburg gerechtfertigt sein.
Die Arbeitnehmerin war als Pflegeassistentin beschäftigt. Sie war für einen Samstag und einen Sonntag zum Spätdienst eingeteilt. Hierfür meldete sie sich krank. In dieser Nacht nahm sie an einem bekannten Veranstaltungsort an der „White Night Ibiza Party“ teil. Der Arbeitgeber kündigte ihr daraufhin fristlos. Hiergegen erhob sie Kündigungsschutzklage. Das ArbG Siegburg wies die Klage ab und bestätigte die fristlose Kündigung. Der wichtige Kündigungsgrund liege darin, dass die Klägerin über ihre Erkrankung getäuscht und das Vertrauen in ihre Redlichkeit zerstört habe. Sie hatte am Tag ihrer angeblich bestehenden Arbeitsunfähigkeit bester Laune und ersichtlich bester Gesundheit an der Party teilgenommen, während sie sich arbeitsunfähig gemeldet hatte – dokumentiert durch Fotos. Der Beweiswert der AU-Bescheinigung war somit erschüttert. Die Erklärung, sie habe an einer zweitägigen psychischen Erkrankung gelitten, die vom Arzt nachträglich festgestellt worden sei, glaubte das Gericht nicht.
Quelle | ArbG Siegburg, Urteil vom 16.12.2022, 5 Ca 1200/22
Baurecht
Honorarvereinbarung: Vergütung über die Zielfindungsphase hinaus
Der Auftragnehmer eines nach dem 1.1.2018 geschlossenen, die Zielfindungsphase ausdrücklich aufnehmenden Architektenvertrags, kann Honorar für darüberhinausgehende Leistungen nur unter der Voraussetzung beanspruchen, dass er die mindestens erforderlichen Ergebnisse jener Phase dem Auftraggeber zur Prüfung vorgelegt und hierzu eine klare Billigungserklärung erhalten hat. So sieht es das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt.
Das OLG hält dafür mindestens die Vorlage einer Kosteneinschätzung für erforderlich, die erkennen lässt, worauf sie sich bezieht und woraus sie hergeleitet ist. Eine vertraglich vereinbarte Kosteneinschätzung in der Gliederung eines Kostenrahmens gemäß der Norm DIN 276 (1. Gliederungsebene) sei mit der bloßen Angabe einer Summe nicht erbracht.
Wegen der mangelnden Finanzierbarkeit des Objekts wurde der Architektenvertrag vom Bauherrn nach der Zielfindungsphase – formnichtig – gekündigt. Da der Architekt der Kündigung aber nicht widersprochen, sondern Schlussabrechnung erteilt hat, ging das OLG von einer einvernehmlichen Vertragsaufhebung aus.
Quelle | OLG Frankfurt, Urteil vom 16.5.2022, 29 U 94/21
Vertragsrecht: Nur was vertraglich vereinbart ist, ist auch geschuldet
Immer wieder gibt es – vor allem im Baurecht – Streit über Vertragsinhalte. Das gilt besonders, wenn später Mängel auftreten. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamburg hat daher klargestellt, dass nur das geschuldet wird, was genau auch so vereinbart war.
Eine Wohnungseigentümergemeinschaft hatte vom Architekten Schadenersatz verlangt. Dieser hatte es im Rahmen seiner Bauüberwachungspflicht unterlassen, das Bauunternehmen von der Herstellung einer Innendrainage am Gebäude abzuhalten und stattdessen eine Außendrainage vorzugeben. Im Vertrag war die Überwachung einer Innendrainage geregelt, obwohl der Architekt vor Auftragserteilung darauf hingewiesen hatte, dass deren Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspreche.
Das OLG hat die Schadenersatzklage abgewiesen. Der Auftragsinhalt werde nicht durch Beschlüsse der Eigentümerversammlung formuliert, sondern anhand des Vertrags zwischen der Eigentümergemeinschaft und dem Architekten (Innendrainage trotz Bedenken des Planers). Hier habe (der bevollmächtigte) Verwalter der Eigentümergemeinschaft den Vertrag mit dem Architekten geschlossen. Von einer Außendrainage stand darin nichts. Da der Architekt seine Bedenken gegen die Innendrainage rechtzeitig vorgebracht und die Eigentümergemeinschaft sich darüber hinweggesetzt hatte, war sein Hinwirken auf eine Außendrainage obsolet.
Auch musste der Eigentümergemeinschaft klar sein, dass sie hier ausdrücklich und gegen den Vorschlag des Architekten eine andere Drainage vorgegeben hatte.
Die Entscheidung ist inzwischen rechtskräftig.
Familien- und Erbrecht
Nichteheliche Lebensgemeinschaft: Keine Ausgleichsansprüche für Luxusausgaben bei gehobenem Lebensstil nach Beziehungsende
Während einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft geschenkte Gegenstände und Geldbeträge können bei grobem Undank zurückgefordert werden. Die dafür erforderliche Verfehlung von gewisser Schwere und eine die Dankbarkeit vermissende Gesinnung konnte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main nach der Trennung eines im gehobenen Lebensstil lebenden Paares nicht feststellen. Es wies Ausgleichsansprüche des Mannes u.a. im Zusammenhang mit Kreditkartenabhebungen über die überlassene Zweitkarte und übergebener Diamant-Ohrringe in seiner Entscheidung zurück.
Das war geschehen
Die sich bereits aus Kindertagen kennenden Parteien hatten über einen Zeitraum von 1 ½ Jahren eine intime Beziehung geführt. Der Kläger überließ der Beklagten eine American Express Platinum Zweitkarte für einen Zeitraum von zehn Monaten. Sie belastete das Konto mit gut 100.000 Euro. Zudem hatte der Kläger u.a. Reisen und Einkäufe bei Chanel bezahlt und ihr Diamant-Ohrringe geschenkt. Im Rahmen der Trennung kam es u. a. zu Sachbeschädigungen durch den Kläger; die Beklagte erstattete Strafanzeige; es wurde ein – aus Sicht des Klägers erschlichenes – Kontaktverbot ausgesprochen. Nun begehrt der Kläger Zahlung von gut 200.000 Euro sowie die Rückgabe der Diamant-Ohrringe.
Kein grober Undank ersichtlich
Das Landgericht (LG) hat die Ansprüche zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Berufung hatte auch vor dem OLG keinen Erfolg. Es bestünden keine Ausgleichsansprüche, bestätigte das OLG. Die Hintergründe für die Überlassung der Kreditkarte seien offengeblieben. Dass ein Darlehen gewährt worden sei, habe der Kläger nicht beweisen können. Soweit der Kläger sich auf „aufaddierende Schenkungen“ berufe, fehle es jedenfalls an einem wirksamen Widerruf dieser Schenkungen. Der für einen Schenkungswiderruf erforderliche „grobe Undank“ liege nicht bereits dann vor, „wenn ein Partner die insoweit unterstellte nichteheliche Lebensgemeinschaft (...) verlässt, da mit der Auflösung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft jederzeit gerechnet werden muss“, betont das OLG. Vorausgesetzt würde vielmehr „objektiv eine Verfehlung des Beschenkten von gewisser Schwere“, die subjektiv „Ausdruck einer Gesinnung des Beschenkten (ist), die in erheblichem Maße die Dankbarkeit vermissen lässt, die der Schenker erwarten kann“. Eine solche subjektiv undankbare Einstellung sei hier nicht feststellbar.
Luxuriöser Lebensstil in diesem Einzelfall
Maßgeblich seien alle relevanten Umstände des Einzelfalls. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die behaupteten Geschenke „einem luxuriösen, exklusiven, eher konsumorientierten Lebensstil entsprangen, zu dem nach dem übereinstimmenden Vortrag der – finanziell gut situierten – Parteien der Einkauf in hochpreisigen Geschäften ebenso wie der regelmäßige Besuch teurer Restaurants ... dazugehörte“. Das Ausgabeverhalten der Parteien habe sich während der Beziehung nicht maßgeblich geändert. Die zurückgeforderten Ausgaben seien auch nicht ersichtlich von großer finanzieller Anstrengung des Klägers oder einer prekären Situation der Beklagten geprägt gewesen. Es habe sich um Einzelbeträge im Bereich zwischen gut 60 Euro und gut 3.000 Euro gehandelt. Angesichts des „emotional aufgeladenen Trennungsgeschehen(s) und der hitzigen Auseinandersetzungen“ stützten auch die weiteren Umstände, u. a. die klägerischen Angaben gegenüber der Polizei, keinen groben Undank.
Keine Änderung der Vermögensverhältnisse durch Ausgabeverhalten
Soweit bei gemeinschaftsbezogenen Aufwendungen (sog. unbenannten Zuwendungen) eine Rückforderung in Betracht komme, wenn sie über das hinausgingen, was das tägliche Zusammenleben erst ermögliche, folge auch daraus hier kein Anspruch. Ein „korrigierender Eingriff ist grundsätzlich nur gerechtfertigt, wenn dem Leistenden die Beibehaltung der durch die Leistung geschaffenen Vermögensverhältnisse nach Treu und Glauben nicht zuzumuten ist“, führt das OLG aus. Auszugleichen seien damit nur solche Leistungen, denen nach den jeweiligen Verhältnissen eine besondere Bedeutung zukomme. Hier seien jedoch allein Ausgaben zu beurteilen, die „ersichtlich den gewöhnlichen Konsum im Hier und Jetzt abdecken, ohne auf die Zukunft gerichtet zu sein“.
Quelle | OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 12.10.2022, 17 U 125/21, PM 78/22
Nachlassschulden: Kinder haften für verstorbene Eltern
Stirbt eine versicherte Person und hat die Rentenversicherung noch offene Forderungen gegen diese, handelt es sich um Nachlassschulden. So entschied es das Bundessozialgericht (BSG). Folge: Die Rentenversicherung darf das Geld von den Erben fordern.
Es ging um Forderungen der Rentenversicherung der Eltern
Die Rentenversicherung forderte rund 5.200 Euro von einer Frau. Sie war damit nicht einverstanden und klagte. Noch bevor ein Urteil ergehen konnte, starb die Frau. Ihr Ehemann, der Alleinerbe, prozessierte weiter, verlor jedoch in zwei Instanzen. Nachdem auch er verstarb, erbten seine zwei Töchter jeweils hälftig. Die Rentenversicherung teilte ihre Forderung hälftig auf und forderte diese Beträge von den Töchtern. Eine der Töchter, die unehelich war, klagte dagegen. Ihr Argument: Die Forderung sei gegen die Ehefrau ihres Vaters gerichtet. Diese sei aber nicht ihre Mutter.
Nachlassverbindlichkeiten
Zum Nachlass gehören auch Verbindlichkeiten. Die Rentenversicherung darf folglich nach dem Tod des Versicherten die Erben in Anspruch nehmen.
Bescheid war allerdings rechtswidrig
Hier gab es jedoch eine Besonderheit: Es gab zwei Erben. In solchen Fällen hat die Rentenversicherung ein sog. „Auswahlermessen“. Das bedeutet, sie darf sich aussuchen, von welchem Erben sie welchen Betrag fordert. Das muss sie allerdings begründen.
Im Fall des BSG hatte sich die Rentenversicherung ausschließlich auf die Erbquote gestützt. Das genügte dem BSG nicht. Folge: Der Rückforderungsbescheid an die uneheliche Tochter war rechtswidrig.
Quelle | BSG, Urteil vom 8.2.2023, B 5 R 2/22
Mietrecht und WEG
Fristlose Kündigung: Die Hausverwaltung besser nicht beleidigen oder bedrohen …
Beleidigt und droht der Mieter der Hausverwaltung, hat das Kündigungsrelevanz. Denn den Vermieter trifft dieser gegenüber eine Schutzpflicht. So hat es das Amtsgericht (AG) München nun entschieden.
Der Vermieter kündigte das Mietverhältnis fristlos und erhob Räumungsklage, weil sich der Mieter gegenüber der Hausverwalterin in einem Brief u. a. so geäußert hatte: „Hoffentlich trifft Sie der Blitz, Frau H.!“. Außerdem hatte er die Hausverwalterin als „grenzdebil“ bezeichnet.
Beleidigungen und Drohungen können einen Grund zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses darstellen, so das AG. Die o. g. Formulierung des Briefs überschreite die Grenze des Zumutbaren ebenso wie die Bezeichnung der Hausverwalterin als „grenzdebil“ und rechtfertige die fristlose Kündigung des Mietverhältnisses ohne vorherige Abmahnung. Von einem Augenblicksversagen durch Spontanäußerungen, das die Beleidigungen in einem milderen Licht erscheinen lasse, könne im Hinblick auf die zweieinhalbseitige schriftliche Abfassung nicht ausgegangen werden.
Zwar ist die Meinungsfreiheit nach dem Grundgesetz (Art. 5 GG) geschützt. Daher überschreitet nicht jede deftige Formulierung die Grenze zur unzulässigen Schmähkritik. Wünscht ein Mieter der Hausverwalterin aber den Tod, ist diese Schwelle überschritten. Die Kündigung ist in solchen Fällen ohne vorherige Abmahnung möglich.
Quelle | AG München, Urteil vom 24.6.2022, 461 C 19994/21
Vertragsgestaltung: Klausel zur Fernabschaltung einer Autobatterie durch den Vermieter unwirksam
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat über die Zulässigkeit einer Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) eines Mietvertrags über eine Autobatterie entschieden, die dem Vermieter eine Fernabschaltung der Batterie ermöglicht.
Das war geschehen
Der Kläger hat als Verbraucherschutzverein gegen die Beklagte, eine französische Bank, die Unterlassung der Verwendung von AGB-Klauseln bei Vermietung von Batterien für Elektrofahrzeuge geltend gemacht. Die Beklagte vermietet Batterien für von ihren Kunden gekaufte oder geleaste Elektrofahrzeuge. Hierfür verwendet sie „Allgemeine Batterie-Mietbedingungen“, die ihr als Vermieterin im Fall der außerordentlichen Vertragsbeendigung durch Kündigung nach entsprechender Ankündigung die Sperre der Auflademöglichkeit der Batterie erlauben. Der Kläger macht geltend, die AGB-Klausel sei unwirksam, weil sie eine unangemessene Benachteiligung der Mieter enthalte.
Das Landgericht (LG) hat die Vermieterin antragsgemäß zur Unterlassung einer Verwendung der Klausel gegenüber Verbrauchern verurteilt. Das Berufungsgericht hat die von ihr eingelegte Berufung zurückgewiesen. Das Sperren der Auflademöglichkeit stelle eine sog. verbotene Eigenmacht dar; ein Eingriff in die unmittelbare Sachherrschaft des Besitzers dürfe aber nur aufgrund eines staatlichen Vollstreckungstitels erfolgen.
So sieht es der Bundesgerichtshof
Der BGH: Die streitgegenständliche Klausel stellt eine einseitige Vertragsgestaltung dar, mit der die Beklagte missbräuchlich die eigenen Interessen auf Kosten der Mieter durchzusetzen versucht, ohne deren Interessen angemessen zu berücksichtigen. Durch die allein in der Macht des Vermieters liegende Sperrmöglichkeit wird die Last, sich die weitere Nutzung zu sichern, auf den Mieter abgewälzt. Darin liegt jedenfalls dann eine unangemessene Benachteiligung des Mieters als Verbraucher, wenn dieser die Weiterbenutzung seines – gesondert erworbenen, geleasten oder gemieteten – E-Fahrzeugs im Streitfall nur durch gerichtliche Geltendmachung einer weiteren Gebrauchsüberlassung der Batterie erreichen kann.
Batteriesperre war unangemessen
Zwar liegt es grundsätzlich im berechtigten Interesse des Vermieters, dass er nach wirksamer Beendigung des Mietvertrags die weitere Nutzung des Mietobjekts unterbinden kann. Auf der anderen Seite steht aber das Interesse des Mieters, sich die weitere Vertragserfüllung zu sichern. Dieses ist als berechtigt anzuerkennen, wenn die Wirksamkeit der Kündigung zwischen den Vertragsparteien streitig ist. Beruft sich etwa der Mieter auf eine Mietminderung oder ein Zurückbehaltungsrecht wegen Mängeln, läuft er Gefahr, dass der Vermieter ungeachtet dessen die Kündigung erklärt und das Mietobjekt per Fernzugriff sperrt. Das gewinnt insbesondere dann an Bedeutung, wenn das Mietobjekt und dessen fortgesetzte Nutzung für den Mieter von erheblichem Interesse sind.
Absicherung über Mietkaution wäre möglich gewesen
Dementsprechend ist die gesetzliche Risikoverteilung beim Mietverhältnis dadurch geprägt, dass der Vermieter aufgrund der Überlassung des Mietobjekts grundsätzlich das Risiko der nach Mietvertragsbeendigung fortgesetzten (Ab-)Nutzung trägt. Dagegen kann er sich durch Vereinbarung einer Mietkaution absichern. Außerdem steht ihm ein Anspruch auf Nutzungsentschädigung zu. Die streitgegenständliche Klausel erlaubt dagegen einen Zugriff auf die Batterie und mittelbar auch auf das E-Fahrzeug, das für den Mieter infolge der Batteriesperrung nutzlos wird. Dadurch, dass die Batterie herstellergebunden und mit dem E-Fahrzeug verknüpft ist, hat der Mieter keine zumutbare Möglichkeit, die gesperrte Batterie durch ein anderes Fabrikat zu ersetzen, um das E-Fahrzeug weiter betreiben zu können. Mit dem E-Fahrzeug wird somit neben der Batterie ein wesentlich höherwertiger Vermögensbestandteil für ihn unbrauchbar bzw. ein Nutzungsrecht daran entwertet. Hinzu kommt, dass das längerfristig angeschaffte bzw. gesondert gemietete oder geleaste E-Fahrzeug vom Mieter oft beruflich genutzt wird und regelmäßig auch für die private Lebensgestaltung von wesentlicher Bedeutung ist.
AGB-Klausel nicht rechtskonform
Wenn unter diesen Umständen bei einem Streit über die Wirksamkeit einer von der Beklagten ausgesprochenen außerordentlichen Kündigung abweichend von der gesetzlichen Risikoverteilung die Klagelast durch AGB auf den Mieter abgewälzt werden soll, verstößt die entsprechende Klausel gegen geltendes Recht (hier: § 307 Abs. 1, 2 BGB). Denn der mit der Sperrung einhergehende Ausschluss von der Nutzung der Batterie und folglich auch des E-Fahrzeugs geht mit seinen Wirkungen über die Batterie als Mietobjekt wesentlich hinaus. Eine solche Gestaltung lässt sich auch nicht durch das Interesse der Beklagten an der Sicherung gegen den mit der Abnutzung der Batterie nach Vertragsbeendigung verbundenen Vermögensschaden rechtfertigen.
Quelle | BGH, Urteil vom 26.10.2022, XII ZR 89/21, PM 151/22
Verbraucherrecht
Reiserecht: Kreuzfahrt: Ohne Corona-Impfung keine Kostenerstattung
Die Corona-Pandemie hat für viele Menschen Einfluss auf deren Urlaubsplanung gehabt. Mit dem Beginn der Impfungen haben auch zahlreiche Reiseveranstalter ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Voraussetzung für die Reise war aber oft ein vollständiger Impfschutz. Das Amtsgericht (AG) Ansbach musste sich nun mit der Klage einer Frau beschäftigen, der der Zugang zu einem Kreuzfahrtschiff wegen fehlender Impfung verweigert wurde. Daher verlangte sie den Reisepreis und die Kosten für eine Übernachtung am Hafen in Höhe von knapp 2.000 Euro von der Reederei zurück.
Das war geschehen
Anfang September 2021 buchte die Frau für ihren Mann und sich bei einer amerikanischen Kreuzfahrtgesellschaft eine Mittelmeerkreuzfahrt. Als das Paar Anfang Oktober die Reise antreten wollte, wurde ihnen der Zugang zum Schiff verweigert, da sie keinen vollständigen Impfschutz durch zwei Impfungen nachweisen konnten. Das Ehepaar war im März 2021 an Corona erkrankt gewesen und hat sich nach der damals gültigen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts noch einmal vor der geplanten Einschiffung impfen lassen.
Internationale Reederei: Empfehlungen des deutschen RKI nicht maßgeblich
Das AG hat die Klage abgewiesen. Die Reederei hatte nämlich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie nur vollständig geimpfte Gäste an Bord lässt, die zweimal mit einem Impfstoff des gleichen Herstellers geimpft sind. Dieser Hinweis fand sich sowohl bei der Buchung als auch auf einer zusätzlichen Informationsseite der Reederei auf deren Homepage. Nachdem es sich bei der Reederei um einen international tätigen Konzern mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten handelt, konnte sich das Ehepaar auch nicht darauf verlassen, dass diese den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts folgen würde. Außerdem war im September 2021 bereits bekannt, dass die meisten Impfstoffe für einen vollständigen Impfschutz zwei Impfdosen benötigten.
Nachdem die Klägerin ihre zunächst eingelegte Berufung wieder zurückgenommen hat, ist das Urteil rechtskräftig.
Quelle | AG Ansbach, Urteil vom 1.4.2022, 2 C 1102/21, PM 4/22
Datenschutzrecht: Schufa-Eintrag bei bestrittener Forderung unzulässig
Haben Inkassounternehmen bei der Einziehung von Forderungen keinen Erfolg, melden sie dies regelmäßig als „Zahlungsstörung“ an die Wirtschaftsauskunftei Schufa. Die Folge: ein negativer Eintrag des Schuldners, der dann Probleme bei der Kreditkartenzahlung oder der Eröffnung eines Girokontos bekommen kann. Das Landgericht (LG) Frankenthal hat nun in einem Eilverfahren gezeigt, dass eine Weitergabe solcher Daten an die Schufa nur in Grenzen zulässig ist. Der Schuldner muss über die Informationsweitergabe unterrichtet werden; wenn er bestreitet, dass die Forderung besteht, darf kein Eintrag erfolgen. Werden die Daten trotzdem übermittelt, kann der Schuldner verlangen, dass die Meldung widerrufen und künftig unterlassen wird.
Das war geschehen
Eine Frau erhielt ein Schreiben eines Inkassounternehmens wegen einer Forderung in Höhe von rund 900 Euro. Der Rückstand sollte aus einem lange zurückliegenden Mietstreit stammen. Die Frau wies die Forderung als nicht begründet zurück und hörte dann erst einmal nichts mehr von der Sache. Einige Monate später erfuhr sie von einem negativen Schufa-Eintrag zu ihrer Person. Aufgrund dieses Eintrags wurde ihre Kreditkarte gesperrt, Kreditkartenzahlungen nicht mehr angewiesen und die Eröffnung eines Girokontos abgelehnt. Sie wandte sich deshalb mit einem Eilantrag an das LG.
Landgericht: Meldung der Zahlungsstörung ist zu widerrufen
Das LG hat das Inkassounternehmen dazu verpflichtet, die Meldung der Zahlungsstörung an die Schufa zu widerrufen. Wegen dieser Forderung darf künftig keine Meldung erfolgen.
Nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sei die Verarbeitung personenbezogener Daten nämlich nur gestattet, wenn dies zur Wahrung von berechtigten Interessen erforderlich sei und nicht die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person verletze. Wer von solchen Einträgen betroffen sei und die Forderung bestreite, müsse deshalb das Recht haben, sich rechtzeitig dagegen zur Wehr zu setzen. Hiergegen sei vorliegend verstoßen worden, so das LG.
Gegen diese Entscheidung im Eilverfahren hat das Inkassounternehmen keinen Widerspruch eingelegt.
Quelle | LG Frankenthal, Beschluss vom 28.6.2022, 8 O 163/22, PM vom 26.10.2022
Privates Veräußerungsgeschäft: Achtung Steuerfalle: vorherige teilweise Vermietung
Wird eine zu eigenen Wohnzwecken genutzte Immobilie innerhalb der Spekulationsfrist (10 Jahre) verkauft, unterfällt der Gewinn insoweit der Besteuerung, als er auf tageweise an Dritte vermietete Räume entfällt. Dieses steuerzahlerunfreundliche Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) ausgesprochen.
Hintergrund: Die Besteuerung des Veräußerungsgewinns eines innerhalb des Zehnjahreszeitraums veräußerten Grundstücks wird vermieden, wenn das Wirtschaftsgut im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde. Dies regelt das Einkommensteuergesetz (§ 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG).
Das war geschehen
Ehegatten kauften 2011 ein Reihenhaus (ca. 150 qm Wohnfläche), das sie mit ihren Kindern bewohnten. 2012 bis 2017 vermieteten sie einzelne Zimmer im Dachgeschoss tageweise (konkret zwischen 12 und 25 Tagen pro Jahr) an Messegäste und erzielten daraus Vermietungseinkünfte. 2017 verkauften die Eheleute die Immobilie. Das Finanzamt unterwarf den Gewinn wegen der zeitweise erfolgten Vermietung einzelner Zimmer teilweise der Besteuerung. Das Finanzgericht (FG) Niedersachsen teilte diese Sichtweise jedoch nicht. Beurteilungsobjekt sei das gesamte Gebäude als Wirtschaftsgut. Die zeitweise Vermietung des Dachgeschosses führe nicht dazu, dass hinsichtlich des Dachgeschosses innerhalb des Gebäudes ein selbstständiges Wirtschaftsgut entstehe, das gesondert zu betrachten wäre. Die Freude der Eheleute währte (leider) nicht lange. Denn der BFH hob die Entscheidung des FG auf.
Bundesfinanzhof: Es gibt keine Bagatellgrenze
Nach Ansicht des BFH ist der Gewinn aus der Veräußerung insoweit nicht von der Einkommensbesteuerung ausgenommen, als er auf tageweise an Dritte vermietete Räume entfällt. Denn eine räumliche oder zeitliche Bagatellgrenze für eine unschädliche Nutzungsüberlassung an Dritte besteht nicht.
Beachten Sie | Maßstab für die Ermittlung des anteilig steuerbaren Veräußerungsgewinns ist das Verhältnis der Wohnflächen zueinander (durchgängig zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnfläche zu vorübergehend zu fremden Wohnzwecken überlassener Wohnfläche). In diesem Zusammenhang ist auf die Wohn- und nicht auf die Nutzflächen abzustellen, weil § 23 EStG die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken privilegiert.
Häusliches Arbeitszimmer unschädlich
Deutlich positiver ist die Sichtweise beim häuslichen Arbeitszimmer. Denn wird eine zu eigenen Wohnzwecken genutzte Immobilie innerhalb der Spekulationsfrist veräußert, ist der Veräußerungsgewinn auch insoweit von der Besteuerung ausgenommen, als er auf ein zur Erzielung von Überschusseinkünften genutztes häusliches Arbeitszimmer entfällt. Dies hat der BFH im Jahr 2021 entschieden.
Quelle | BFH, Urteil vom 19.7.2022, IX R 20/21, BFH, Urteil vom 1.3.2021, IX R 27/19
Diffamierung im Internet: Wer „löschen“ muss, muss gründlich sein …
Häufig beantragen Gläubiger Ordnungsgelder gegen Schuldner, wenn diese diffamierende Internetinhalte nicht löschen. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hat noch einmal betont, wie weitreichendend die Pflichten der Schuldner sind: Diese müssen auch an Verlinkungen und Cachespeicher von Suchmaschinen denken. Sie können nicht damit argumentieren, dass sie den Überblick verloren haben.
Das war geschehen
Der Schuldner hatte auf einer Internetplattform einen Artikel veröffentlicht („Ist Frau K. S. eine Kinderrechteschänderin?“) und verlinkte in einer Online-Gruppe auch zu seinem Artikel. Das Landgericht (LG) Stade verpflichtete ihn, es zu unterlassen, sich über die Gläubigerin identifizierend zu äußern oder zu verbreiten oder verbreiten zu lassen, diese wäre eine Kinderrechteschänderin. Obwohl ihm der Beschluss schon am 4.4.2022 zuging, waren Links zu dem Artikel danach noch abrufbar. Den Artikel selbst hatte er allerdings schon gelöscht. Die Gläubigerin legte dem Gericht Screenshots vor, sodass dieses wegen Zuwiderhandlung gegen seine Unterlassungsverpflichtung ein Ordnungsgeld von 1.000 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, gegen den Schuldner verhängte.
Inhalte sind nachhaltig aus dem Netz zu entfernen
Schuldner müssen in solchen Fällen den „fortdauernden Störungszustand“ beseitigen. Bezogen auf Aussagen im Internet heißt das, dass mit geeigneten Maßnahmen sicherzustellen ist, dass die Inhalte nicht mehr im Netz abrufbar sind, und zwar weder über die Webseite direkt noch über eine Internetsuchmaschine. Es besteht die Pflicht, auf gängige Suchmaschinen – vor allem Google – einzuwirken, damit der gelöschte Beitrag nicht weiter über Suchmaschinen infolge einer Speicherung in deren Cachespeicher erreichbar ist. Der Schuldner hätte also in den besuchten Gruppen aktiv nach seinen auch älteren, weiter zurückliegenden Beiträgen forschen und sie löschen lassen müssen.
Quelle | OLG Celle, Beschluss vom 19.8.2022, 5 W 25/22; OLG Celle, Beschluss vom 21.8.2017, 13 W 45/17
Verkehrsrecht
Betrugsrisiko: Vorsicht bei unbegleiteten Probefahrten
Wer einem Kaufinteressenten einen Pkw für eine unbegleitete Probefahrt überlässt, riskiert im schlimmsten Fall, dass der vermeintliche Interessent das Fahrzeug einer anderen Person wirksam verkauft und übereignet. Ein solcher Fall lag nun dem Oberlandesgericht (OLG) Celle vor.
Das war geschehen
Ein Autohaus gab einem angeblichen Kaufinteressenten einen Audi Q5 für eine einstündige Probefahrt. Der Interessent, der falsche Personalien angegeben hatte, kehrte nicht zurück. Stattdessen inserierte er das Fahrzeug auf der Verkaufsplattform Ebay und verkaufte es schließlich für 31.000 Euro in bar. Bei dem Verkauf übergab seine Frau dem Käufer gefälschte Fahrzeugpapiere. Der Käufer übergab das Fahrzeug zwei Wochen später der Polizei, die es dem Autohaus zurückgab. Dieses verkaufte es anschließend für 35.000 Euro. Der getäuschte Käufer verlangt diesen Erlös heraus.
Getäuschter Käufer verklagte das Autohaus
Zu Recht, so das OLG, weil er das Eigentum wirksam von dem „Betrüger“ erlangt hatte. Zwar kann grundsätzlich nur der Eigentümer wirksam über eine Sache verfügen. Übergibt ein Nichtberechtigter die Kaufsache aber beim Verkauf an den Käufer, kann dieser auch dann Eigentümer werden, wenn die Sache tatsächlich nicht dem Verkäufer gehörte.
Autohaus handelte fehlerhaft
Ein solcher sog. gutgläubiger Erwerb von einem Nichtberechtigten scheidet zwar aus, wenn die Kaufsache dem wahren Eigentümer gestohlen wurde oder ihm sonst abhandengekommen ist. Hier hatte das Autohaus den Wagen aber freiwillig für eine unbegleitete einstündige Probefahrt herausgegeben. Damit hatte es den Besitz an dem Pkw freiwillig aufgegeben, auch wenn das Auto über eingebaute SIM-Karten geortet werden konnte. Diese Ortungsmöglichkeit stand einer Begleitung bei der Probefahrt schon deshalb nicht gleich, weil eine Ortung nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung über die Polizei und den Hersteller möglich war. Sie schloss einen gutgläubigen Erwerb des Wagens daher nicht aus.
Professionelle Fälschung der Kfz-Papiere nicht zu erkennen
Darüber hinaus scheidet ein gutgläubiger Erwerb zwar auch dann aus, wenn der Käufer grob fahrlässig nicht erkannt hat, dass der Verkäufer nicht der Eigentümer war. Bei dem Kauf eines Kraftfahrzeugs muss er sich zumindest den Kraftfahrzeugbrief bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil II vorlegen lassen, um die Berechtigung des Veräußerers zu prüfen. Die Zulassungsbescheinigung war hier aber so professionell gefälscht, dass der Käufer die Fälschung nicht erkennen musste. Der Verkauf eines gebrauchten Pkw auf der Straße gegen Bargeld ist nach Auffassung des Senats auch nicht unüblich und musste keinen Verdacht erwecken, zumal der Kaufpreis nicht auffallend günstig war. Dass der Verkäufer den Zweitschlüssel nicht mit übergeben konnte, hatte er nachvollziehbar damit erklärt, dass sich der Käufer erheblich verspätet hatte, er selbst nicht habe warten können und vergessen habe, seiner Frau den Zweitschlüssel zu geben.
Quelle | OLG Celle, Urteil vom 12.10.2022, 7 U 974/21, PM vom 20.10.2022
Fahreignung: Fahrerlaubnisentziehung wegen Nichtvorlage eines fachärztlichen Gutachtens
Das Verwaltungsgericht (VG) Trier hat einen Eilantrag gegen eine Fahrerlaubnisentziehung wegen Nichtbeibringung eines angeforderten fachärztlichen Gutachtens über die Fahreignung abgelehnt.
Das war geschehen
Der 89-jährige Antragsteller wurde im Februar des Jahres von der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde dazu aufgefordert, sich einer fachärztlichen Untersuchung zu unterziehen, weil Zweifel an seiner Fahreignung entstanden seien. Nach einem hausärztlichen Attest leide er unter Hypertonie und Sturzneigung. Hinzu kämen zahlreiche weitere Aspekte, die Bedenken gegen die Fahreignung nahelegten. Der Senior sei 2017 und 2021 in Parkraumunfälle verstrickt gewesen und habe bei den jeweiligen Unfallaufnahmen durch Polizeibeamte einen verwirrten Eindruck hinterlassen. Anlässlich der letzten Verkehrsunfallaufnahme sei zudem eine Vielzahl von alten Unfallschäden am gesamten Fahrzeug festgestellt worden. Diese Schäden habe der Senior nicht plausibel erklären können, sondern habe insoweit widersprüchliche Angaben gemacht.
Angefordertes Gutachten nicht vorgelegt
Der Senior legte ein entsprechendes Gutachten innerhalb der ihm gesetzten Frist von vier Monaten nicht vor; einen ihm angebotenen Begutachtungstermin im Juni des Jahres nahm er nicht wahr. Daraufhin entzog ihm die Fahrerlaubnisbehörde mit für sofort vollziehbar erklärtem Bescheid die Fahrerlaubnis.
Fahrerlaubnisrechtliche Nichteignung des Seniors
Zu Recht, so das VG. Die Fahrerlaubnisbehörde sei rechtlich zutreffend von der fahrerlaubnisrechtlichen Nichteignung des Seniors ausgegangen, nachdem dieser das im Februar angeforderte fachärztliche Gutachten nicht vorgelegt habe. Sie sei berechtigt, Aufklärungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn Tatsachen bekannt würden, die für sich gesehen noch nicht für eine rechtsfehlerfreie Annahme einer fahrerlaubnisrechtlichen Nichteignung ausreichten, die aber konkrete Bedenken an der Fahreignung des Betroffenen begründeten. Weigere der Betroffene sich, eine berechtigterweise angeordnete Begutachtung durchführen zu lassen, oder lege er das Untersuchungsergebnis nicht fristgerecht vor, könne die Behörde auf die Nichteignung schließen.
Begründete Bedenken an Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen
Vorliegend sei die Gutachtensanforderung berechtigterweise erfolgt. Der Fahrerlaubnisbehörde seien Tatsachen bekannt geworden, die Bedenken an der körperlichen oder geistigen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen begründeten. Ausreichend seien insoweit alle Tatsachen, die nachvollziehbar den Verdacht rechtfertigten, es könne eine Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen vorliegen. Ob solche Verdachtsmomente vorlägen, beurteile sich nach den gesamten Umständen des Einzelfalls. Diese rechtfertigten vorliegend die getroffene Gutachtensanordnung.
Erkrankungen und Vielzahl an Unfallschäden lagen vor
Die ärztlich attestierte Hypertonie und Sturzneigung reichten für sich genommen bereits aus, um Zweifel an der Eignung des Seniors zum Führen von Kraftfahrzeugen zu begründen; erst recht gelte dies in der Gesamtschau der vielen bekannt gewordenen weiteren Umstände. Anlässlich der Verkehrsunfallaufnahmen 2017 und 2021 habe er einen verwirrten Eindruck und teilweise nicht nachvollziehbare Angaben zum Unfallgeschehen gemacht. Im Übrigen seien im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme viele alte Unfallschäden am Pkw vorgefunden worden, deren Entstehung nicht nachvollziehbar, sondern vielmehr mit sich widersprechenden Angaben erklärt worden sei. All dies begründe erhebliche Eignungszweifel. Die dem Senior eingeräumte Frist von vier Monaten zur Vorlage des Gutachtens sei angemessen gewesen. Er habe im Juni des Jahres auch die Möglichkeit zur Wahrnehmung eines Gutachtertermins gehabt. Diesen habe er jedoch in vorwerfbarer Weise nicht wahrgenommen.
Quelle | VG Trier, Beschluss vom 13.9.2022, 1 L 2108/22.TR, PM 24/22
Frontalunfall: (Keine) Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr?
Wer sich sieben Wochen in einem Land mit Linksverkehr aufhielt, handelt regelmäßig lediglich unachtsam und nicht rücksichtslos, wenn er bei seiner ersten Fahrt in Deutschland gegen das Rechtsfahrgebot verstößt. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken nun klargestellt.
Siebenwöchiger Urlaub in Thailand
Der Angeklagte verbrachte einen siebenwöchigen Urlaub in Thailand. Noch am Tag seiner Rückkehr fuhr er mit seinem Pkw auf der linken Spur einer Landstraße. Nach zwei bis drei Minuten Fahrtzeit kollidierte er in einem Kurvenbereich frontal mit einem auf derselben Fahrspur entgegenkommenden Pkw. Der Angeklagte hatte sich weder vor Fahrtantritt noch während der Fahrt darüber Gedanken gemacht, dass in Deutschland – anders als in Thailand – Rechtsverkehr herrscht. Die Unfallgegnerin und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt.
Amtsgericht und Landgericht mit „harten Entscheidungen“
Das Amtsgericht (AG) hat den Angeklagten wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen verurteilt, die Fahrerlaubnis entzogen und die Verwaltungsbehörde angewiesen, ihm vor Ablauf von weiteren acht Monaten keine neue Fahrerlaubnis zu erteilen. Das Landgericht (LG) Kaiserslautern hat diese Entscheidung bestätigt.
Oberlandesgericht lässt Milde walten
Auf die hiergegen gerichtete Revision des Angeklagten hat das OLG das Urteil dahin geändert, dass der Angeklagte der fahrlässigen Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen schuldig ist, nicht jedoch der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung. Wegen der deshalb auszusprechenden Rechtsfolgen muss sich das LG erneut mit dem Fall befassen.
Zur Begründung hat das OLG ausgeführt: Eine fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung setze ein rücksichtsloses Handeln voraus, was im Fall des Angeklagten nicht angenommen werden könne. Rücksichtslos handele ein Fahrer, der sich konkret seiner Pflicht bewusst sei, sich aber dennoch nicht an sie halte. Rücksichtslos handele auch, wem es egal sei, ob er sich an seine Pflichten als Teilnehmer im Straßenverkehr halte und einfach, ohne an die Folgen zu denken, drauflosfahre. Es müsse sich um ein überdurchschnittliches Fehlverhalten handeln, das von einer besonders verwerflichen Gesinnung geprägt sei. Gelegentliche Unaufmerksamkeit oder reine Gedankenlosigkeit würden hierfür nicht genügen. Der Angeklagte habe sich hier zwar über das Rechtsfahrgebot hinweggesetzt. Dabei habe er aber nicht bewusst oder aus Gleichgültigkeit gegenüber anderen Straßenverkehrsteilnehmern gehandelt, sondern lediglich aus Unachtsamkeit, nachdem er sich sieben Wochen in einem Land aufgehalten habe, in dem Linksverkehr herrsche.
Quelle | OLG Zweibrücken, Beschluss vom 28.11.2022, 1 OLG 2 Ss 34/22, PM vom 6.2.2023
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
Marktaufsichtsbehörde: Nichtselbsttätige Waagen für den Einzelhandel dürfen ohne eigenes Display vertrieben werden
Nach den maßgeblichen unionsrechtlichen Regelungen können sog. nichtselbsttätige Waagen, mit denen in vielen Supermärkten das Wiegen von Obst und Gemüse an der Kasse ermöglicht wird, auch ohne eigenes Display mit der CE-Kennzeichnung versehen und als vollständige Waagen in Verkehr gebracht werden. Zudem kann es genügen, die messtechnischen Werte zur Höchstlast, Mindestlast und zum Eichwert ausschließlich im Display anzuzeigen. Dies hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster bezogen auf zwei marktaufsichtsrechtliche Ordnungsverfügungen des Landesbetriebs Mess- und Eichwesen entschieden.
Das war geschehen
Die Klägerinnen sind jeweils Hersteller sog. nichtselbsttätiger Waagen, die für den Verkauf in öffentlichen Verkaufsstellen verwendet werden sollen. Zwischen den Beteiligten war zum einen streitig, ob ein Gerät zur Gewichtsbestimmung, das für den Einsatz im Einzelhandel in Kassensysteme anderer Hersteller integriert wird und so das Wiegen beim Kassiervorgang ermöglicht, bereits mit der CE-Kennzeichnung versehen werden darf, wenn es am Ende der Fertigung noch nicht über ein eigenes Display verfügt. Nach Ansicht der Marktaufsichtsbehörde entstehe erst mit Anschluss des Geräts an das Kassen-Display eine nichtselbsttätige Waage, weil diese zwingend eine Anzeigeeinrichtung erfordere. Die Anbringung der CE-Kennzeichnung, mit der zum Ausdruck gebracht werde, dass das fertige Produkt die wesentlichen Anforderungen an eine nichtselbsttätige Waage erfülle und das Konformitätsbewertungsverfahren erfolgreich bestanden habe, dürfe daher erst nach Anschluss an das Kassensystem erfolgen. Zum anderen war zwischen den Beteiligten streitig, ob – so der Landesbetrieb – die nach den rechtlichen Vorschriften zum Mess- und Eichwesen erforderlichen Angaben zur Höchstlast (Max), Mindestlast (Min) und zum Eichwert (e) zwingend analog auf dem Messgerät angebracht werden müssen oder ob eine ausschließlich digitale Anzeige der Angaben genügen kann.
Musterverfahren
Beide Verfahren sind als Musterverfahren geführt worden, um Rechtsfragen zu klären, die unter den Mess- und Eichbehörden und den Konformitätsbewertungsstellen nicht einheitlich beurteilt worden sind. In beiden Verfahren hat der Landesbetrieb Vorgehensweisen von Waagenherstellern beanstandet, die zuvor jeweils von den Konformitätsbewertungsstellen als ordnungsgemäß bescheinigt worden waren.
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen hatte keinen Erfolg
Das OVG ist den Erwägungen des Landesbetriebs in beiden Verfahren nicht gefolgt. Zur Begründung seiner Entscheidungen hat es im Wesentlichen ausgeführt: Eine nichtselbsttätige Waage kann den gerätespezifischen Anforderungen auch genügen, wenn beim Inverkehrbringen der Waage sichergestellt ist, dass Anforderungen, die erst bei der Verwendung im geschäftlichen Verkehr für die gesamte Nutzungsdauer relevant sind, ab der Inbetriebnahme erfüllt werden. Ein Hersteller, der ein Gerät als vollständige Waage vertreiben will, das alle Anforderungen an eine Waage erfüllt, aber über keine eigene digitale Hauptanzeigeeinrichtung verfügt, muss „bei Entwurf und Herstellung“ gewährleisten, dass sein Gerät nur mit einem geeigneten Display in Betrieb genommen werden kann und die Vereinbarkeit mit den wesentlichen gerätespezifischen Anforderungen an die Anzeige des Wägeergebnisses ab Inbetriebnahme und damit bei Verwendung des Geräts für Messungen im geschäftlichen Verkehr sichergestellt ist.
Ausschließlich digitale Anzeige erfüllt Anforderungen
Weiter kann auch die ausschließlich digitale Anzeige zur Höchstlast, Mindestlast und zum Eichwert im Display für die Gewichtsanzeige die rechtlichen Anforderungen der guten Sichtbarkeit, Leserlichkeit und Dauerhaftigkeit erfüllen, weshalb ein Display eine geeignete Einrichtung zum Anbringen der messtechnischen Kennwerte darstellen kann. Damit eine digitale Anzeige dauerhaft bzw. unauslöschlich und damit für die Aufschrift bzw. Beschriftung „geeignet“ ist, hat der Hersteller bei Entwurf und Herstellung des Geräts zu gewährleisten, dass die für die Anzeige der messtechnischen Werte verantwortliche Software entsprechend den gerätespezifischen technischen Anforderungen an nichtselbsttätige Waagen vor unbeabsichtigtem Missbrauch geschützt und eine Veränderung der angezeigten messtechnischen Werte verhindert wird.
Internationale Standards und europäische Vorgaben erfüllt
Dieses Normverständnis steht im Einklang mit internationalen technischen Standards und entspricht dem Bestreben des europäischen Richtliniengebers, sich auf die wesentlichen messtechnischen und technischen Anforderungen an nichtselbsttätige Waagen zu beschränken. Der deutsche Gesetzgeber hat die europäischen Vorgaben unverändert in nationales Recht übernommen.
Der Senat hat wegen grundsätzlicher Bedeutung in beiden Verfahren die Revision zum Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) zugelassen.
Quelle | OVG Münster, Urteil vom 9.9.2022, 4 A 1278/21, PM vom 29.9.2022
Berechnung der Verzugszinsen
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 beträgt 1,62 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 6,62 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 10,62 Prozent
- für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 9,62 Prozent.
Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).
Übersicht / Basiszinssätze
| Zeitraum | Zinssatz |
|---|---|
| 01.07.2022 bis 31.12.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2022 bis 30.06.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2021 bis 31.12.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2021 bis 30.06.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2020 bis 31.12.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2020 bis 30.06.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2019 bis 31.12.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2019 bis 30.06.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2018 bis 31.12.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2018 bis 30.06.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2017 bis 31.12.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2017 bis 30.06.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2016 bis 31.12.2016 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2016 bis 30.06.2016 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2015 bis 31.12.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.01.2015 bis 30.06.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2014 bis 31.12.2014 | -0,73 Prozent |
| 01.01.2014 bis 30.06.2014 | -0,63 Prozent |
| 01.07.2013 bis 31.12.2013 | -0,38 Prozent |
| 01.01.2013 bis 30.06.2013 | -0,13 Prozent |
| 01.07.2012 bis 31.12.2012 | 0,12 Prozent |
| 01.01.2012 bis 30.06.2012 | 0,12 Prozent |
| 01.07.2011 bis 31.12.2011 | 0,37 Prozent |
| 01.01.2011 bis 30.06.2011 | 0,12 Prozent |
| 01.07 2010 bis 31.12.2010 | 0,12 Prozent |
| 01.01.2010 bis 30.06.2010 | 0,12 Prozent |
| 01.07 2009 bis 31.12.2009 | 0,12 Prozent |
| 01.01.2009 bis 30.06.2009 | 1,62 Prozent |