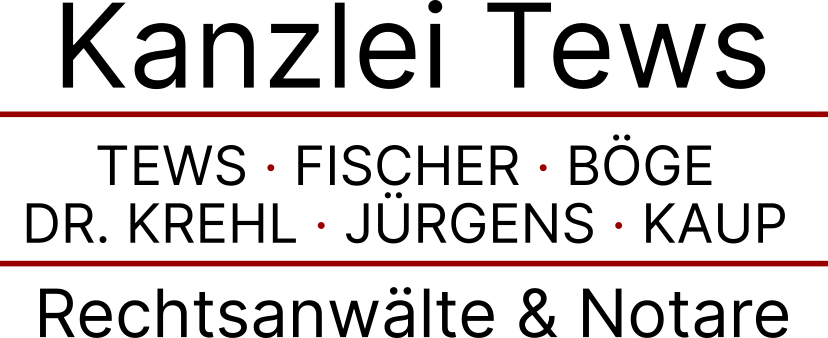November 2025
- November 2025
- Arbeitsrecht
- Baurecht
- Familien- und Erbrecht
- Mietrecht und WEG
- Verbraucherrecht
- Verkehrsrecht
- Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
- Unlauterer Wettbewerb: Gutschrift von Payback-Punkten im Gesamtwert von mehr als einem Euro beim Kauf von Hörgeräten ist unzulässig
- Arbeitgeber: Firmenfitnessprogramm: Zählen für die Sachbezugsfreigrenze registrierte oder „aktive“ Arbeitnehmer?
- Berechnung der Verzugszinsen
- Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 11/2025
Arbeitsrecht
Schwerbehindertenrechte: Arbeitgeber muss selbst die Schwerbehinderung kennen
Dem Arbeitgeber kann weder die Kenntnis der Schwerbehindertenvertretung noch die eines Fachvorgesetzten von der Schwerbehinderung des Arbeitnehmers zugerechnet werden. So sieht es das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln in einer aktuellen Entscheidung.
Keine rechtsgeschäftlichen Vertreter
Weder die Schwerbehindertenvertretung noch der Fachvorgesetzte des Arbeitnehmers hätten eine Stellung, die einem rechtsgeschäftlichen Vertreter des Arbeitgebers ähnlich sei. Denn die Schwerbehindertenvertretung vertrete die Interessen der schwerbehinderten Menschen gegenüber dem Arbeitsgericht. Sie sei nicht seiner Sphäre zuzurechnen.
Schwerbehindertenvertretung kümmert sich nicht um personalrechtliche Belange Sie kümmere sich auch nicht um personalrechtliche Belange aus der Sicht des Arbeitgebers, sondern allenfalls aus der Sicht der schwerbehinderten Mitarbeiter.
Quelle | LAG Köln, Urteil vom 7.5.2025, 4 SLa 438/24
(Keine) Gleichstellung: Leiharbeitnehmerin erhält keine Inflationsausgleichsprämie
Ein Arbeitsgericht (ArbG) hatte bereits im letzten Jahr entschieden, dass ein Leiharbeitnehmer nicht ohne Weiteres eine Inflationsausgleichsprämie erhält, die im Entleiherbetrieb den dort Beschäftigten gezahlt wird. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein hat dies nun bestätigt.
So sah es die Arbeitnehmerin
Die Klägerin wurde von ihrer Arbeitgeberin, einem Arbeitnehmerüberlassungsunternehmen, in einem Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie („Entleiherin“) eingesetzt. Das Arbeitsverhältnis endete zum 31.7.2023. Der Arbeitsvertrag der Parteien verwies u. a. auf die für Leiharbeitnehmer geltenden Tarifverträge über Branchenzuschläge für die Metall- und Elektroindustrie („TV BZ ME“) sowie Inflationsausgleichsprämie („TV IAP ME“). Die Entleiherin füllte der Beklagten einen „Fragebogen zur Ermittlung von Equal Pay sowie des Branchenzuschlags ab dem 16. Einsatzmonat“ aus.
Die Mitarbeiter im Betrieb der Entleiherin erhielten im Juni 2023 eine Inflationsausgleichsprämie i.H.v. 1.000 Euro, die Klägerin dagegen nicht. Sie macht nun gerichtlich diese 1.000 Euro sowie weitere 1.200 Euro geltend.
Für die erste Zahlung bestehe durch den Fragebogen eine Equal-Pay-Vereinbarung zwischen der Klägerin und ihrer Arbeitgeberin, der Beklagten. Im Übrigen sei die Gleichstellung nicht per Tarifvertrag ausgeschlossen worden.
Hinsichtlich der zweiten Zahlung könne die Inflationsausgleichsprämie nach dem TV IAP ME bereits verlangt werden, wenn deren Voraussetzungen nach Inkrafttreten des Tarifvertrags, aber vor dem ersten Auszahlungszeitpunkt im Januar 2024 erfüllt gewesen seien. Damit sei die Prämie auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses auszuzahlen.
Landesarbeitsgericht: keine Equal-Pay-Vereinbarung und fehlender Vortrag
Das LAG entschied, dass der o. g. ausgefüllte Fragenbogen keine Equal-Pay-Vereinbarung mit deren Arbeitnehmern darstellt. Die Klägerin hat auch nicht die Voraussetzungen für eine Gleichstellung mit den Mitarbeitern der Entleiherin vorgetragen.
Dazu muss sie als darlegungs- und beweisbelaste Klägerin einen Gesamtvergleich der Entgelte im Überlassungszeitraum vornehmen. Dem wird sie nicht gerecht: Der Verweis, der Klägerin müsse die Inflationsausgleichsprämie schon deshalb gezahlt werden, weil die Stammarbeitnehmer der Entleiherin diese erhalten hätten, reicht dafür nicht aus.
Die Klägerin kann die Inflationsausgleichsprämien auch nicht aus dem TV IAP ME beanspruchen: Die Auslegung des Tarifvertrags ergibt, dass im jeweiligen Auszahlungsmonat (Januar bis November 2024) der tariflichen Inflationsausgleichsprämien – anders als die Klägerin meint – noch ein Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien bestanden haben muss. Hier endete das Arbeitsverhältnis mit der Klägerin aber bereits im Jahr 2023.
Quelle | LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 6.3.2025, 5 Sa 222 d/24, PM des LAG
Arbeitsvertrag: Darf eine Spielhallenaufsicht ihren Hund mitbringen?
Diese Frage musste das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf klären. Es neigte dazu, sie negativ zu beantworten. Die Parteien haben sich daraufhin entsprechend einem Vorschlag es Gerichts verglichen.
Das war geschehen
Die Klägerin ist seit 2013 in Vollzeit und im Schichtdienst an fünf Tagen in der Woche als Spielhallenaufsicht bei der Beklagten beschäftigt. Diese betreibt Spielhallen mit üblichem Publikumsverkehr und bietet dort u.a. Getränke an. Ausweislich der arbeitsvertraglich vereinbarten Stellenbeschreibung sind Haustiere in der Spielhalle verboten.
Im Jahr 2019 schloss die Klägerin mit der Hundehilfe Deutschland e.V. einen Tierüberlassungsschutzvertrag. Nachdem zunächst auch der Vater der Klägerin auf die Hündin aufgepasst hatte, brachte sie das Tier jedenfalls nach dem Ende der Corona-Lockdowns regelmäßig mit zur Arbeit. Verschiedene wechselnde Vorgesetzte erhoben zunächst keine Einwände. Ihr aktueller Vorgesetzter teilte ihr mit, dass der Geschäftsführer das Mitbringen der Hündin an den Arbeitsplatz nicht dulden werde bzw. – so die Klägerin – würde. Der Geschäftsführer der Beklagten bat die Klägerin dann schriftlich unter Bezugnahme auf die Stellenbeschreibung, es künftig zu unterlassen, die Hündin mit zur Arbeit zu bringen.
So sah es das Landesarbeitsgericht
Mit ihrer einstweiligen Verfügung hat die Klägerin begehrt, der Beklagten aufzugeben, die Mitnahme der Hündin während ihrer Arbeitszeiten in die Spielhalle bis zur erstinstanzlichen Entscheidung in der Hauptsache zu dulden. Die Kammer hat dann in der mündlichen Verhandlung im Rechtsgespräch mitgeteilt, dass sie davon ausgehe, dass das vertragliche Verbot weiterbestehen dürfte.
Die bloße Nichtdurchsetzung eines Verbots führe nicht zu dessen Aufhebung. Es spreche viel dafür, dass die Arbeitgeberin berechtigt sei, dies durchzusetzen, weil Kunden die Spielhalle z. B. aufgrund einer Tierhaarallergie oder Angst vor Hunden ggf. erst gar nicht aufsuchten. In der Verhandlung hat die Arbeitgeberin zudem angeführt, dass Beschäftigte in anderen von ihr betriebenen Spielhallen begännen, sich auf die von der Klägerin gelebte Praxis zu berufen.
Vergleich geschlossen
Das LAG hat dann mitgeteilt, dass die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Arbeitsgerichts (ArbG) Düsseldorf, das den Antrag der Klägerin auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen hatte, wenig Aussicht auf Erfolg habe. Um die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses und eine Gewöhnung der Hündin an andere Betreuungsmöglichkeiten zu ermöglichen, haben die Parteien auf Vorschlag des Gerichts einen Vergleich – auch zur Erledigung der Hauptsache – geschlossen. Die Klägerin durfte ihre Hündin noch für eine Übergangszeit von knapp zwei Monaten an den Arbeitsplatz mitbringen, danach jedoch nicht mehr.
Quelle | LAG Düsseldorf, Vergleich vom 8.4.2025, 8 GLa 5/25, PM vom 8.4.2025
Baurecht
Architektenrecht: Neues zum Kopplungsverbot
Lange war es ruhig um das sog. Kopplungsverbot. Jetzt hat das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg einen solchen Fall entschieden. Dieses stellt klar: Tritt ein Architekt wie ein Bauträger auf, findet das Kopplungsverbot Anwendung. Der Vertrag ist – wie hier entschieden – nichtig.
Das besagt das Kopplungsverbot
Das Kopplungsverbot im Architektenrecht verbietet es, den Erwerb eines Grundstücks mit der Pflicht zu verbinden, einen bestimmten Architekten oder Ingenieur damit zu beauftragen, ein Bauwerk zu planen oder auszuführen. So soll der freie Wettbewerb unter Architekten geschützt werden. Außerdem soll so verhindert werden, dass sich Einzelne durch die Verknüpfung von Grundstückserwerb und Architektenleistung eine monopolartige Stellung verschaffen.
Bauherren werden geschützt
Das Verbot richtet sich gegen jede, mit dem Erwerb eines Grundstücks zusammenhängende Bindung, die den Wettbewerb von Ingenieuren und Architekten beeinträchtigt. Die Vorschrift soll der Gefahr entgegenwirken, dass ein Architekt oder Ingenieur sich bei knapp gewordenem Baugrund dadurch Wettbewerbsvorteile verschafft, dass er ein Grundstück an der Hand hat.
Geschützt wird die Entschließungsfreiheit des Bauherrn, durch den Kauf eines Grundstücks, auf dem gebaut werden soll, nicht an einen bestimmten Architekten oder Ingenieur gebunden zu sein.
Quelle | OLG Nürnberg, Beschluss vom 8.5.2025, 6 U 1787/24,
Architektenrecht: Verstoß gegen Fortbildungspflicht kann Kammerausschluss bedeuten
In Architekten- und Ingenieurkammern, in denen die Fortbildung eine Berufspflicht ist und kontrolliert wird, kann das Nichtvorweisen entsprechender Fortbildungspunkte zum Ausschluss aus der jeweiligen Kammer führen. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen klargestellt.
Fortbildungspflicht nicht erfüllt – zunächst Verweis und Geldbuße
Ein Mitglied der Ingenieurkammer-Bau NRW hatte in einem Jahr seine Fortbildungspflicht nicht erfüllt. Er hatte deshalb einen Verweis erhalten und musste eine Geldbuße zahlen.
Erneuter Pflichtverstoß: Kammerausschluss
Drei und sechs Jahr später geschah das Gleiche. Weil der Ingenieur auch bei der nächsten Stichprobe erneut keine Teilnahmebescheinigungen für anerkannte Fortbildungsveranstaltungen vorlegen konnte, schloss ihn das Berufsgericht aus der Kammer aus.
Oberverwaltungsgericht bestätigt Kammerausschluss
Die Klage dagegen wies das OVG ab. Der Ausschluss sei die angemessene berufsgerichtliche Maßnahme, auch wenn es sich um die schärfste berufsgerichtliche Sanktion handele. Die nochmalige Festsetzung einer Geldbuße als mildere Maßnahme komme nicht in Betracht.
Quelle | OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 19.8.2025, 39 A 834/24
Bundesverwaltungsgericht: Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch: Begriff des „Dritten“
Verkauft eine Kommanditgesellschaft ein Grundstück an eine andere Kommanditgesellschaft, ist dies auch dann ein Kaufvertrag mit einem Dritten im Sinne des Baugesetzbuchs (hier: § 28 Abs. 2 S. 2 BauGB in Verbindung mit § 463 BGB), wenn es sich auf Verkäufer- und Käuferseite jeweils um Einpersonen-GmbH & Co. KGs mit demselben alleinigen Anteilsinhaber handelt. Das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in zwei Parallelverfahren entschieden.
Das war geschehen
Die Klägerinnen, verschiedene GmbH & Co. KGs, wenden sich gegen die Ausübung von Vorkaufsrechten nach § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB. Mit notariellen Kaufverträgen von Mai 2021 veräußerten sie Grundstücke an zuvor neu gegründete GmbH & Co. KGs, hinter denen jeweils dieselbe natürliche Person steht, wie auf Verkäuferseite.
Mit Bescheiden von Juli 2021 übte die Beklagte das Vorkaufsrecht aus, in einem Fall zugunsten der beigeladenen stadteigenen Entwicklungsgesellschaft. Im anderen Verfahren gab die Erstkäuferin (Klägerin zu 2) eine Abwendungserklärung ab.
Klagen zunächst erfolgreich
Die Klagen waren erfolgreich. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat die Berufungen zurückgewiesen. Das Verwaltungsgericht (VG) habe zu Recht angenommen, dass es an dem für ein Vorkaufsrecht erforderlichen Kaufvertrag mit einem Dritten im Sinne von § 463 BGB fehle. Der Begriff des Dritten müsse einschränkend ausgelegt werden. Bei wirtschaftlicher Betrachtung sei hier nur eine Vermögensverschiebung innerhalb der Vermögenssphäre derselben natürlichen Personen erfolgt.
So sah es das Bundesverwaltungsgericht
Das BVerwG hat die angefochtenen Urteile aufgehoben und die Sachen zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das OVG zurückverwiesen. Die Grundstückskaufverträge sind Verträge mit einem Dritten.
Gesellschaftsrechtlich sind die Kommanditgesellschaften auf Verkäufer- und Käuferseite trotz des Umstands, dass hinter ihnen jeweils dieselbe natürliche Person steht, selbstständige Rechtsträger. Eine wirtschaftliche Betrachtung auf Gesellschafterebene ist weder nach Sinn und Zweck des gesetzlichen Vorkaufsrechts noch verfassungsrechtlich geboten. Die Klägerinnen haben sich aus eigenem Entschluss für diese Form der Grundstücksübertragung entschieden.
Das BVerwG konnte mangels ausreichender Tatsachenfeststellungen nicht abschließend entscheiden, ob die Vorkaufsrechte im Übrigen rechtmäßig ausgeübt wurden. Das erfordert die Zurückverweisung an die Vorinstanz.
Quelle | BVerwG, Urteil vom 17.6.2025, 4 C 4.24, PM 46/25
Familien- und Erbrecht
Haftung: Geburtsschäden: Gericht spricht Rekord-Schmerzensgeld zu
Das Landgericht (LG) Göttingen hat einer Patientin aufgrund eines Geburtsschadens ein Schmerzensgeld von einer Mio. Euro zugesprochen.
Dem medizinischen Personal der Beklagten wurde vorgeworfen, einen erforderlichen Notkaiserschnitt nicht durchgeführt zu haben, trotz klarer Anzeichen für den schlechten Gesundheitszustand der noch ungeborenen Klägerin. Nach der Geburt wurde diese zudem nicht ausreichend überwacht oder mit Sauerstoff versorgt, und die Benachrichtigung des spezialisierten neonatologischen Notdienstes der Universitätsmedizin Göttingen wurde versäumt.
Die Klägerin leidet aufgrund dieser Fehler an schwersten körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen, die eine vollständige Rundumbetreuung erfordern und sich nicht mehr bessern werden.
Quelle | LG Göttingen, Urteil vom 14.8.2025, 12 O 85/21
Zuwendungsverbot: Zuwendung von Todes wegen an einen behandelnden Arzt
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden: Eine Zuwendung von Todes wegen zugunsten des Hausarztes des Erblassers ist nicht unwirksam, weil sie gegen ein den Hausarzt treffendes berufsständisches Zuwendungsverbot verstößt.
Das war geschehen
Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das Vermögen eines Hausarztes, der den Erblasser seit 2015 behandelt hatte. Im Januar 2016 schloss der Erblasser mit dem Hausarzt sowie der ihn pflegenden Beklagten und deren Tochter vor einem Notar eine als „Betreuungs-, Versorgungs- und Erbvertrag“ bezeichnete Vereinbarung. In dieser verpflichtete sich der Hausarzt gegenüber dem Erblasser zu verschiedenen ärztlichen Leistungen, unter anderem zu medizinischer Beratung und Behandlung, zu Hausbesuchen und telefonischer Erreichbarkeit sowie zu Betreuungsleistungen im häuslichen Bereich. Als Gegenleistung sollte der Arzt im Falle des Todes des Erblassers das Eigentum an einem dem Erblasser gehörenden Grundstück erhalten. Im März 2016 verfügte der Erblasser in einem notariellen Testament, dass ihn die Beklagte hinsichtlich seines im Vertrag vom Januar 2016 nicht erfassten Vermögens allein beerben solle.
Im Januar 2018 verstarb der Erblasser. Die Pflegerin (Beklagte) nahm seinen Nachlass in Besitz. Im Dezember 2019 wurde über das Vermögen des Hausarztes das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Kläger hat als Insolvenzverwalter die Beklagte auf Übertragung des dem Arzt in der Vereinbarung vom Januar 2016 zugewandten Grundstücks an die Insolvenzmasse in Anspruch genommen.
So sah es der Bundesgerichtshof
Die Zuwendung des Grundstücks an den Hausarzt im Wege des Vermächtnisses ist wirksam. Selbst, wenn der Arzt gegen seine Berufsordnung verstoßen hätte, indem er die Zuwendung annahm, führt dies nicht zur Unwirksamkeit des Vermächtnisses.
Die Berufsordnung für Ärzte (hier: § 32 Abs. 1 S. 1 BO-Ä) regelt als berufsständische Vorschrift das Verhältnis zwischen dem Arzt und der für ihn zuständigen Landesärztekammer. Die Vorschrift verbietet deshalb nur ein Verhalten des Arztes, dem es nicht gestattet ist, Geschenke oder andere Vorteile zu fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen. Nicht geschützt von diesem Verbot wird hingegen der zuwendende Patient oder die Erwartung seiner Angehörigen, diesen zu beerben. Die Vorschrift zielt darauf ab, die Unabhängigkeit des behandelnden Arztes sowie das Ansehen und die Integrität der Ärzteschaft zu sichern. Dies kann durch berufsrechtliche Sanktionen vonseiten der Ärztekammer ausreichend sichergestellt werden.
Patient hatte Testierfreiheit
Auch die Testierfreiheit des Patienten verbietet es, ein zugunsten des behandelnden Arztes angeordnetes Vermächtnis wegen Verstoßes gegen eine Berufsordnung für unwirksam zu halten. Für eine Beschränkung der Testierfreiheit des Patienten fehlt schon eine ausreichende gesetzliche Grundlage.
Berufungsgericht muss erneut prüfen
Der Senat hat deshalb das Berufungsurteil aufgehoben. Er hat die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen, das den Parteien noch Gelegenheit geben muss, zu einem von ihm bislang nicht geprüften Verstoß der Vereinbarung des Vermächtnisses in dem Erbvertrag gegen die guten Sitten vorzutragen.
Quelle | BGH, Urteil vom 2.7.2025, IV ZR 93/24, PM 122/25
Mietrecht und WEG
Energiekosten: Strom- und Gaslieferungsverträge bei Vermietung einzelner Zimmer einer Wohnung durch separate Mietverträge
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden: Bei Fehlen eines schriftlichen Energieversorgungsvertrags richtet sich das Leistungsangebot eines Strom- und Gasversorgungsunternehmens an den Vermieter (Eigentümer) – und nicht, wie sonst regelmäßig der Fall, an den Mieter. Dies gilt im Fall einer Wohnung, wenn die einzelnen Zimmer durch separate Mietverträge vermietet sind und diese lediglich über einen Zähler für Strom und Gas verfügt.
Das war geschehen
Die Klägerin, ein Energieversorgungsunternehmen, nahm die beklagte Vermieterin auf Zahlung von Entgelt für die Belieferung mit Strom und Gas im Rahmen der Grundversorgung in Anspruch. Die Zimmer der Wohnung waren einzeln mit gesonderten Mietverträgen über unterschiedliche Laufzeiten vermietet, wobei sämtlichen Mietern das Recht zur Nutzung der Gemeinschaftsräume, wie Küche und Bad, eingeräumt wurde. Nur die Wohnung, nicht hingegen die einzelnen Zimmer, verfügte über einen Zähler für Strom und Gas und wurde von der Klägerin mit Strom und Gas beliefert. Ein schriftlicher Energieversorgungsvertrag bestand nicht. Die Parteien stritten, ob ein durch die Entnahme von Strom und Gas konkludent zustande gekommener Versorgungsvertrag mit der Vermieterin (Eigentümerin) oder mit den Mietern besteht.
Die auf Zahlung der Versorgungsentgelte für einen Zeitraum von fünf Jahren gerichtete Klage hat das Amtsgericht (AG) abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Landgericht (LG) das erstinstanzliche Urteil geändert und der Klage stattgegeben. Die Beklagte begehrte beim BGH daher, das klageabweisende erstinstanzliche Urteil wiederherzustellen.
So entschied der Bundesgerichtshof
Der BGH hat die Revision der Beklagten zurückgewiesen. Das Berufungsgericht, so der BGH, hat zu Recht angenommen, dass unter den hier gegebenen Umständen ein Versorgungsvertrag mit der beklagten Vermieterin der Wohnung besteht. Entgegen der Ansicht der Revision war das in der Bereitstellung von Strom und Gas liegende (konkludente) Angebot der Klägerin weder an die Mieter der einzelnen Zimmer noch an die Gesamtheit der Mieter gerichtet.
Zwar haben allein die Mieter Einfluss auf den Strom- und Gasverbrauch in der Wohnung. Jedoch lässt sich dieser Verbrauch – mangels separater Zähler – nicht den einzelnen vermieteten Zimmern zuordnen. Zudem haben die einzelnen Mieter bei objektiver Betrachtung typischerweise kein Interesse daran, auch für die Verbräuche der anderen Mieter einzustehen. Der Umstand, dass sich das konkludente Angebot des Energieversorgungsunternehmens daher an die Vermieterin richtete, ist Folge des von ihr gewählten besonderen Vermietungskonzepts.
Quelle | BGH, Beschluss vom 15.4.2025, VIII ZR 300/23, PM 79/25
Zustimmungspflicht: Anspruch auf Zustimmung der WEG zum Einbau einer weiteren Balkontür
Was dürfen Eigentümer einer Wohnungseigentümergemeinschaft beim Thema Gestaltung ihrer Wohnung und was nicht? Diese Frage beschäftigt Gerichte immer wieder – so auch das Amtsgericht (AG) München in einem aktuellen Fall.
Das beabsichtigten die Eigentümer
Die Kläger sind Eigentümer einer Wohnung in einem neunstöckigen Wohnkomplex. Die Balkone des Gebäudes sind mit einer Loggia ausgestattet. Die Eigentümer der Wohnung planten, zusätzlich zur bereits bestehenden Balkontür, in einem anderen Zimmer der Wohnung ein vorhandenes Fenster zur Balkontür umbauen zu lassen. Hierfür beantragten sie die Zustimmung der Wohnungseigentümergemeinschaft.
Eigentümergemeinschaft verweigerte die Zustimmung
Diese verweigerte jedoch die Zustimmung aufgrund von Bedenken im Zusammenhang mit der konstruktiven Stabilität, der Gefahr von Kälte- und Wassereintritt und der Sorge, dass die Versetzung eines aktuell vor dem Fenster befindlichen Heizkörpers Auswirkungen auf das Heizungssystem des Gebäudes habe.
Klage vor dem Amtsgericht
Da die Eigentümer sich im Recht wähnten, verklagten sie die Eigentümergemeinschaft vor dem AG auf Zustimmung. Dieses gab den Klägern Recht. Es ersetzte die grundsätzliche Zustimmung zum geplanten Umbau und legte der Eigentümergemeinschaft auf, die Modalitäten und Einzelheiten in der Eigentümerversammlung zu beschließen.
Das AG sagt: Der Umbau eines Fensters stelle jedenfalls hinsichtlich des Mauerdurchbruchs durch die Außenwand eine auf Dauer angelegte gegenständliche Veränderung des Gemeinschaftseigentums dar, die über die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung hinausgehe und damit eine bauliche Veränderung des gemeinschaftlichen Eigentums darstelle.
Das Wohnungseigentumsgesetz (hier: § 20 Abs. 3 WEG) begründe einen Anspruch auf Gestattung einer baulichen Veränderung, durch die kein Wohnungseigentümer in rechtlich relevanter Weise beeinträchtigt werde. Eine Beeinträchtigung sei rechtlich nicht relevant, wenn sie nicht über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinausgehe oder die über dieses Maß hinaus beeinträchtigten Wohnungseigentümer einverstanden seien.
Soweit nicht auszuschließen sein soll, dass durch den Einbau eines neuen Heizkörpers Nachteile für das übrige Heizungssystem entstehen könnten, mache die Beklagte keine konkrete und objektive Beeinträchtigung geltend, durch die ein Wohnungseigentümer sich beeinträchtigt fühlen könne. Vielmehr handele es sich hier um ein nicht zu berücksichtigendes hypothetisches Risiko. Auch dass sich der Wandausschnitt, der durch den Einbau einer Terrassentür vergrößert würde, in der Außenmauer des Gebäudes befinde, und damit Gemeinschaftseigentum verändert würde, stelle für sich genommen keine erhebliche Beeinträchtigung dar.
Vorliegend sei nicht ersichtlich, in welcher Weise die in Rede stehende Maßnahme andere Eigentümer konkret beeinträchtigen würde. Soweit die Beklagte geltend mache, es bestünden nicht auszuschließende Folgen für die Abgeschlossenheit der Wohnung sowie die statische Sicherheit, handele es sich wiederum um rein theoretische Bedenken, denen durch entsprechende Auflagen, wie dem Verlangen nach fachkundiger Planung und ggf. statischer Berechnung durch ein Fachunternehmen nach den Regeln der Baukunst, Rechnung getragen werden könne.
Soweit die Beklagte weiter geltend mache, durch eine Veränderung in der Außenhülle des Gebäudes bestehe die Gefahr von Kälte- oder Wassereintritt, sei nicht ersichtlich, inwiefern dies andere Wohnungseigentümer als die Kläger beeinträchtigen sollte. Zudem handele es sich im Hinblick darauf, dass der von dem Mauerdurchbruch betroffenen Wand die Loggia vorgelagert sei, um theoretische Befürchtungen und nicht um konkrete und objektive Beeinträchtigungen.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Quelle | AG München, Urteil vom 27.5.2025, 1293 C 26254/24, PM 27/25
Verbraucherrecht
Waffenrecht: Nach Trunkenheitsfahrt mit schwerem Unfall: Jäger bekommt keinen neuen Jagdschein
Ein Jäger, der im betrunkenen Zustand seine Jagdwaffe im Pkw transportiert, besitzt nicht die erforderliche waffenrechtliche Zuverlässigkeit zur (Wieder-)Erteilung eines Jagdscheins – unabhängig davon, ob die mitgeführte Waffe geladen war oder nicht. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Münster entschieden.
Jäger verursachte hohen Schaden
Der Jäger aus dem Kreis Coesfeld war im Jahr 2020 in Rheinland-Pfalz auf dem Rückweg von einer Jagdveranstaltung und transportierte seine Langwaffe im Fahrzeug. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, fuhr zwei Verkehrsschilder um und in eine Hauswand. Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Ein Atemalkoholtest nach dem Unfall ergab einen Wert von 1,69 Promille, zwei Blutentnahmen Werte von 1,48 und 1,39 Promille. Nach dem Unfall nahm der Kläger seine in einem Futteral befindliche Langwaffe aus dem Fahrzeug und stellte sie in ein nahes Wartehäuschen, wo sie von der Polizei sichergestellt wurde.
Antrag auf erneutes Ausstellen eines Jagdscheins
Es kam zu einem Strafverfahren. Zudem wurde die Waffenbesitzkarte des Mannes widerrufen, sodass er seine Schusswaffen abgeben musste. In der Zwischenzeit lief die Gültigkeit seines Jagdscheins aus. Im Jahr 2022 beantragte der Kläger dann die erneute Ausstellung eines Jagdscheins, blieb damit bei der Behörde jedoch ohne Erfolg.
Die Klage hiergegen wies das Gericht nun ab, denn der Kläger sei waffenrechtlich unzuverlässig. Es rechtfertigten Tatsachen die Annahme, dass er mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig oder sachgemäß umgehe oder diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren werde. Bei der zu treffenden Prognose genüge es, wenn bei Würdigung aller Umstände eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen nicht ordnungsgemäßen Umgang mit Waffen bestehe. Im Bereich des Waffenrechts müsse kein Restrisiko hingenommen werden. Ob, wie zuletzt zwischen den Beteiligten streitig, die Waffe im Auto des Klägers bei der Trunkenheitsfahrt geladen war, und ob er sie nach dem Unfall genügend beaufsichtigt hat, könne offenbleiben. Genügende Anhaltspunkte für einen nicht ordnungsgemäßen Umgang des Klägers mit Waffen ergäben sich bereits daraus, dass er seine Jagdwaffe bei einer Autofahrt mitgeführt hat, obwohl er eine Atemalkoholkonzentration von 1,69 Promille bzw. eine Blutalkoholkonzentration von 1,48 Promille aufwies und sich damit in einem Zustand befand, in dem alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auftreten können und vorliegend – in Form der zu dem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden führenden Unaufmerksamkeit – auch aufgetreten sind.
Als Waffenbesitzer unzuverlässig
Die Blutalkoholkonzentration übersteige den Grenzwert absoluter Fahruntüchtigkeit von Kraftfahrern (1,1 Promille). Mit einer Schusswaffe gehe nicht vorsichtig und sachgemäß um, wer diese in einem Zustand gebrauche, in dem alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auftreten können – unabhängig davon, ob solche auch tatsächlich aufträten. Das gelte auch für das Mitführen einer erlaubnispflichtigen Schusswaffe bei einer Autofahrt in alkoholisiertem Zustand, das waffenrechtlich als „Führen der Schusswaffe“ einzuordnen sei.
Es bestehe zum einen die Gefahr, dass der Waffenbesitzer in einer Konfliktsituation mit anderen Verkehrsteilnehmern aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen inadäquat reagieren und zur Konfliktlösung auf die von ihm mitgeführte Schusswaffe zurückgreifen könnte. Zum anderen bestehe beim Transport einer Schusswaffe im Straßenverkehr bei alkoholbedingten Ausfallerscheinungen des Waffenbesitzers die reale Möglichkeit des Abhandenkommens der Schusswaffe. Jedenfalls dann, wenn es – wie hier – zu einem Unfall kommt, bestehe das Risiko, dass der Betroffene nicht mehr in der Lage ist, den Zugriff Dritter auf die Waffe auszuschließen. Dass der Kläger zwischenzeitlich seinen Führerschein wiedererlangt habe, ändere an dem Ergebnis nichts.
Quelle | VG Münster, Urteil vom 1.4.2025, 1 K 2756/22, PM vom 7.4.2025
Verkehrsrecht
Haftungsfrage: Anscheinsbeweis bei streitigem Spurwechsel
Manchmal kommt es darauf an, welcher Unfallhergang der wahrscheinlichste ist. In einem solchen Fall musste nun das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a. M. entscheiden.
Unfallhergang streitig
Auf der Autobahn stockte der Verkehr, weil die Dreispurigkeit in eine Zweispurigkeit überging. Ein Fahrzeugführer wollte von links in die mittlere Spur wechseln, brach den bereits eingeleiteten Spurwechselvorgang aber ab, weil das Fahrzeug vor ihm auf der mittleren Spur voll abgebremst wurde. Er wechselte nach links zurück. Wie weit er bereits mittig war, ist streitig. Das ihm folgende Fahrzeug fuhr auf und schob ihn auf das Vorderfahrzeug auf. Das war der wahrscheinlichste Unfallhergang.
Kläger war der Eigentümer des vordersten Fahrzeugs. Beklagter war das Büro Grüne Karte e. V. als Quasiversicherer hinter dem Auffahrenden. Von dort wurde vorgetragen, sowohl das Vorderfahrzeug als auch das davor seien von der Mitte nach links gewechselt, ohne zuvor links gefahren zu sein. Am Ende war der Unfallhergang nicht aufklärbar. War der verhinderte Spurwechsler bereits seit Längerem auf der linken Spur, hätte der Auffahrende seinen Abstand daran ausrichten müssen – wenn nicht, dann nicht.
Anwendung des Anscheinsbeweises
Das OLG wandte den Anscheinsbeweis gegen den Auffahrenden an. Dieser ist eine juristische Methode, bei der aus einem typischen Geschehensablauf auf eine bestimmte Ursache oder ein bestimmtes Verhalten geschlossen wird, weil dies nach allgemeiner Lebenserfahrung sehr wahrscheinlich ist. Er erleichtert die Beweisführung, da die beweisende Partei nicht den gesamten konkreten Einzelfall beweise, sondern nur den typischen Sachverhalt darlegen muss.
Hier handele es sich möglicherweise nicht um das typische Geschehen eines Spurwechsels des Vorausfahrenden. Und weil das nicht klar sei, gelte, so das OLG: Stehe nicht fest, ob über das – für sich gesehen typische – Kerngeschehen hinaus Umstände vorliegen, die, sollten sie gegeben sein, der Annahme der Typizität des Geschehens entgegenstünden, stehe der Anwendung des Anscheinsbeweises nichts entgegen. Denn in diesem Fall bleibe dem Gericht als Grundlage allein das typische Kerngeschehen, das ohne besondere Umstände als Basis für den Anscheinsbeweis ausreicht.
Anscheinsbeweis hier nicht widerlegt
Sei also ein Sachverhalt unstreitig, zugestanden oder positiv festgestellt, der die für die Annahme eines Anscheinsbeweises erforderliche Typizität aufweist, muss derjenige, zu dessen Lasten der Anscheinsbeweis angewendet werden soll, darlegen und ggf. beweisen, dass weitere Umstände vorliegen, die dem feststehenden Sachverhalt die Typizität wieder nehmen. Er muss den Anscheinsbeweis erschüttern. Das sei im vorliegenden Fall nicht gelungen.
Quelle | OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 15.7.2025, 30 U 28/25
Verkehrssicherungspflicht: Unfall in Tiefgarage: Betonsockel ist kein überraschendes Hindernis
Eine Frau parkte in der Tiefgarage ihres Arbeitgebers. Beim Ausparken stieß sie mit der Beifahrertür ihres BMW versehentlich gegen einen rechteckigen, ca. kniehohen Sockel einer Säule. Der Sockel befand sich unterhalb der Sichtachse und war nicht gekennzeichnet oder markiert. Sie verlangte Schadenersatz. Ihre Klage wies das Amtsgericht (AG) München ab.
Das verlangte die Klägerin
Die Klägerin behauptet, durch den Unfall sei ein Schaden an der Beifahrertür von über 3.200 Euro netto entstanden. Der Sockel sei bei Umbaumaßnahmen im Zeitraum 2019 bis 2022 errichtet worden. Die Klägerin habe erfahren, dass es mehrere Unfälle an dem Betonsockel gegeben habe. Sie verklagte daraufhin das Bauunternehmen, das die Verkehrssicherungspflicht für die von ihm durchgeführten Arbeiten übernommen hatte.
Die beklagte Baufirma gab an, der Sockel stünde dort bereits seit 50 Jahren. Sie bezweifelte, dass der Schaden vollständig auf einen Kontakt mit dem Sockel zurückzuführen sei.
So urteilte das Amtsgericht
Das AG wies die Klage ab. Begründung: Das Bauunternehmen habe bereits keine sog. Verkehrssicherungspflicht verletzt. Der Betonsockel stellte schon keine besondere Gefahrenquelle für Fahrzeuge in einer Parkgarage dar. Dabei sei zu berücksichtigen, dass jeder Kraftfahrer in einer Parkgarage ohnehin nur so schnell fahren darf, dass er im Hinblick auf die ständig zu erwartenden Ein- und Ausparkvorgänge, aber auch wegen des dort herrschenden Fußgängerverkehrs jederzeit anhalten kann. Beim Ein- und Ausparkvorgang sei es daher jederzeit möglich, anzuhalten, auszusteigen und sich zu vergewissern, wie breit die Fahrbahn oder der Parkplatz an dieser Stelle ist.
Dies gelte insbesondere hinsichtlich des streitgegenständlichen Betonsockels, der von allen Seiten gut sichtbar sei, da er breiter sei als die dahinterstehende Säule. Ein kniehoher Betonsockel sei auch kein überraschendes Hindernis für Parkgaragennutzer, da enge Parkbuchten in einer älteren Parkgarage durchaus üblich seien.
Altschäden auf Fahrfehler zurückzuführen
Selbst, wenn man unterstelle, dass mehrere Fahrer mit ihren Fahrzeugen den Betonsockel in der Vergangenheit gestreift haben sollen, was angesichts eines vorgelegten Fotos und den darauf sichtbaren Lackspuren durchaus plausibel erscheine, sei eine Gefahr, dass Rechtsgüter Dritter durch den statischen Betonsockel verletzte werden, für das Bauunternehmen nicht erkennbar gewesen. Dieses habe als sog. Verkehrssicherungspflichtige darauf vertrauen dürfen, dass die Parkgaragennutzer den gut sichtbaren Betonsockel erkennen und, sofern ihr Fahrzeug zu breit für den Parkplatz sei, eine andere noch freie Parkbucht ohne einen Betonsockel nutzen. Beschädigungen des Sockels durfte das Bauunternehmen daher auf Fahrfehler zurückführen.
Mitverschulden der Autofahrerin
Selbst, wenn man eine Verkehrssicherungspflicht annehmen würde, träfe die Frau ein Mitverschulden, das eine Haftung des Bauunternehmens vollständig entfallen ließe. Die Klägerin nutzte die Parkgarage ihres Arbeitgebers bereits fast zwei Monate nach den Umbaumaßnahmen. Ihr waren sowohl der Zustand der Parkgarage als auch ihre baulichen Merkmale aufgrund der längeren Nutzung bekannt oder sie hätten ihr bekannt sein müssen.
Quelle | AG München, Urteil vom 9.8.2024, 231 C 13838/24. PM 13/25
Haftungsverteilung: Kollision zwischen Bus nach Rotlichtverstoß und Wendemanöver durchführendem PKW
Kommt es zur Kollision zwischen einem Linienbus, der bei Rot mit leicht erhöhter Geschwindigkeit in einen Kreuzungsbereich einfährt, und einem PKW, der eine Linksabbiegespur zu einem Wendemanöver nach einem Gelblichtverstoß nutzt, ist eine Haftungsverteilung von 4/5 zulasten des Busfahrers und 1/5 zulasten des PKW angemessen. So entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main.
Es ging um Schadenersatz nach einem Verkehrsunfall
Die Parteien streiten um Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurde die Mutter des Klägers tödlich verletzt.
Der Kläger fuhr mit dem PKW seines Vaters in südliche Fahrtrichtung in die vom Beklagten in nördliche Richtung genutzte Straße. Der Kläger ordnete sich im Kreuzungsbereich auf der Linksabbiegerspur hinter vier weiteren Fahrzeugen ein. Nach dem Umschalten des Linksabbiegerpfeils auf „Grün“ fuhr der Kläger als fünftes und letztes Fahrzeug in die Abzweigung ein. Der aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung kommende Beklagte steuerte einen Linienbus und kollidierte bei seiner Geradeausfahrt mit dem Fahrzeug des Klägers. Er behauptet, seine Ampel habe „Grün“ gezeigt.
Mithaftung des Pkw-Fahrers
Das Landgericht (LG) hatte der Schadenersatzklage bei Annahme einer alleinigen Haftung des Beklagten ganz überwiegend stattgegeben. Auf die hiergegen eingelegte Berufung des Beklagten entschied das OLG, dass den Kläger eine Mithaftung in Höhe von 1/5 treffe.
Kein unabwendbares Ereignis
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei davon auszugehen, dass für keinen der Beteiligten der Unfall ein unabwendbares Ereignis gewesen sei, führte das OLG aus. Zulasten des Beklagten wirke, dass die Ampel für den Bus unmittelbar vor der Kollision bereits seit mindestens 22 Sekunden „Rot“ gezeigt habe. Dass eine Fehlschaltung in Form eines sog. „feindlichen Grüns“ vorgelegen habe, sei auszuschließen. Die Ampelanlage sei auf ihre Funktionsfähigkeit hin geprüft worden. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass der Busfahrer mit 58 km/h und damit mit leicht überhöhter Geschwindigkeit gefahren sei.
Zulasten des Klägers wirke, dass dieser sich ungewöhnlich lange im Kreuzungsbereich aufgehalten habe. Er habe unter Nutzung der Linksabbiegespur ein Wendemanöver beabsichtigt. Dadurch habe er sich infolge der geringeren Geschwindigkeit länger (9 Sekunden) als üblich (4-4,5 Sekunden) im Kreuzungsbereich aufgehalten. Er habe die Kollision mit dem für ihn sichtbaren Bus bei rechtzeitiger Bremsung vermeiden können. Zudem sei von einem Gelblichtverstoß des Klägers auszugehen.
So verteilt das Oberlandesgericht die Haftung
Die Abwägung der Verursachungsbeiträge aufseiten des Beklagten (Rotlichtverstoß, überhöhte Geschwindigkeit und erhöhte Betriebsgefahr des Busses) und des Klägers (Gelblichtverstoß, längeres Aufhalten im Kreuzungsbereich infolge Wendemanövers) führe zu einer Haftungsverteilung von 4/5 zulasten des Beklagten und 1/5 zulasten des Klägers.
Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.
Quelle | OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 23.9.2025, 10 U 213/22, PM 52/25
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
Unlauterer Wettbewerb: Gutschrift von Payback-Punkten im Gesamtwert von mehr als einem Euro beim Kauf von Hörgeräten ist unzulässig
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden: Die Wertgrenze für geringwertige Kleinigkeiten bei der Publikumswerbung mit Werbegaben für Medizinprodukte ist bei einem Euro zu ziehen.
Das war geschehen
Die Klägerin ist die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs. Die Beklagte vertreibt in ihren Filialen in Deutschland Hörgeräte einer Vielzahl von Herstellern und sonstige Produkte für Hörbeeinträchtigte. Sie warb auf ihrer Internetseite mit der Gutschrift von Payback-Punkten bei jedem Einkauf und der Umwandlung von Payback-Punkten in Sachprämien, Gutscheine, Spenden oder Prämienmeilen. Pro Euro Umsatz wird ein Payback-Punkt im Wert von 1 Cent gutgeschrieben.
Die Klägerin ist der Auffassung, die Werbung mit Payback-Punkten für den Kauf von Hörgeräten verstoße gegen das Verbot von Werbegaben gemäß § 7 Abs. 1 Heilmittelwerbegesetz (HWG). Sie hat die Beklagte auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen.
So sieht es der Bundesgerichtshof
Die Werbung mit der Gutschrift von Payback-Punkten für jeden Einkauf bei der Beklagten ist als produktbezogen und damit vom Anwendungsbereich des Heilmittelwerbegesetzes erfasst anzusehen. Auch eine Werbung für das gesamte Warensortiment kann produktbezogen sein. Es genügt zudem, dass die Werbung auch auf den Absatz von Medizinprodukten gerichtet ist.
Bei der Werbung für Heilmittel ist das Anbieten, Ankündigen und Gewähren von Werbegaben dem Heilmittelwerbegesetz (hier: § 7 Abs. 1 S. 1 HWG) verboten. Für die beanstandete Werbemaßnahme gilt keine Ausnahme.
Bei der Gutschrift von Payback-Punkten handelt es sich nicht um eine Werbegabe, die im Sinn des HWG in einem bestimmten oder auf bestimmte Art zu berechnenden Geldbetrag gewährt wird. Dieser Ausnahmetatbestand erfasst allein unmittelbar wirkende Preisnachlässe und Zahlungen, nicht aber Werbegaben, die – wie die mit der angegriffenen Werbung beworbene Gutschrift von Payback-Punkten – erst im Rahmen von Folgetransaktionen realisiert werden können. Derlei Werbegaben begründen im Gegensatz zu zulässigen Barrabatten die Gefahr einer unsachlichen Motivation des Erstkaufs von Heilmitteln, weil nicht mit einer Preisreduktion für das gewünschte Heilmittel, sondern mit einem Vorteil beim Erwerb anderer Waren geworben wird, der in keinerlei Zusammenhang mit dem Erwerb des Heilmittels steht.
Werbegaben müssen geringwertige Kleinigkeiten sein
Solche Werbegaben sind daher nur als geringwertige Kleinigkeiten im Sinn einer besonderen Ausnahmeregelung des HWG zulässig, deren Voraussetzungen hier jedoch nicht vorliegen. Unter den Begriff der geringwertigen Kleinigkeit fallen allein Gegenstände von so geringem Wert, dass eine relevante unsachliche Beeinflussung der Werbeadressaten als ausgeschlossen erscheint. Bei der Beurteilung, ob eine geringwertige Kleinigkeit vorliegt, ist nicht auf den einzelnen Payback-Punkt, sondern auf die Summe der für den Kauf jedes einzelnen Medizinprodukts gewährten Payback-Punkte abzustellen. Unter Berücksichtigung der leichteren Beeinflussbarkeit der Werbeadressaten bei einer Publikumswerbung im Vergleich zur Fachkreiswerbung sowie des Umstands, dass die unterschiedliche Ausgestaltung von Werbegaben den Preisvergleich bei nicht preisgebundenen Arzneimitteln und Medizinprodukten für die Verbraucherinnen und Verbraucher erschwert, ist die insoweit maßgebliche Wertgrenze entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht erst bei 5 Euro, sondern bereits bei 1 Euro zu ziehen. Die Werbung für Hörgeräte mit einer Gutschrift von Payback-Punkten im Gesamtwert von mehr als 1 Euro je Einkauf eines Produkts ist deshalb unzulässig.
Quelle | BGH, Urteil vom 17.7.2025, I ZR 43/24, PM 135/25
Arbeitgeber: Firmenfitnessprogramm: Zählen für die Sachbezugsfreigrenze registrierte oder „aktive“ Arbeitnehmer?
Bei der Frage, ob die Sachbezugsfreigrenze gemäß Einkommensteuergesetz (hier: § 8 Abs. 2 S. 11 EStG) in Höhe von 50 Euro pro Monat überschritten wird, sind die vom Arbeitgeber aufgewandten Kosten anteilig den für die Nutzung des Firmenfitnessprogramms registrierten Arbeitnehmern zuzurechnen. Auf die Anzahl der vom Arbeitgeber erworbenen Lizenzen kommt es nicht an, wenn diese nicht der Zahl der für das Programm registrierten Arbeit-nehmer entspricht. Dies hat das Finanzgericht (FG) Niedersachsen entschieden.
Beispiel in Anlehnung an den Urteilssachverhalt
Die A-GmbH hat 100 Arbeitnehmer. Sie schließt mit dem Fitnessstudiobetreiber X eine Firmenfitness-Mitgliedschaftsvereinbarung, wonach die Arbeitnehmer der A-GmbH berechtigt sind, das Fitnessstudio des X zu nutzen.
Somit erwirbt die A-GmbH 50 Lizenzen für monatlich 4.000 Euro inkl. Umsatzsteuer. Die Anzahl wurde anhand der Personalstruktur als Kalkulationsgrundlage für X prognostiziert. Die Lizenzen haben keine Auswirkung auf die Menge der tatsächlich nutzungsberechtigten Arbeitnehmer.
Mitarbeiter, die das Angebot in Anspruch nehmen wollen, haben im Fitnessstudio eine Berechtigung vorzulegen, die X aufgrund der mitgeteilten Namen erstellte. Von den 100 Mitarbeitern haben sich 80 für das Fitnessprogramm angemeldet. Tatsächlich teilgenommen haben 50 Mitarbeiter.
Nach Auffassung der Finanzverwaltung sind die Kosten auf die Anzahl der Lizenzen zu verteilen. Das würde im Beispiel bedeuten, dass je Arbeitnehmer 80 Euro (4.000 Euro/50 Lizenzen) zu berücksichtigen wären, mithin der Betrag in voller Höhe steuerpflichtig wäre.
Finanzgericht widersprach der Finanzverwaltung
Dem widersprach jedoch das FG: Entspricht die Anzahl der Lizenzen nicht der Zahl der für das Programm registrierten Mitarbeiter, kommt es auf die Menge der Lizenzen nicht an. Vielmehr sind dann die vom Arbeitgeber aufgewandten Kosten anteilig den für die Nutzung des Firmenfitnessprogramms registrierten Mitarbeitern zuzurechnen. Im Beispiel ergeben sich somit 50 Euro je Arbeitnehmer (4.000 Euro/80 Arbeitnehmer). Da der Betrag nicht die Freigrenze übersteigt, ist er nicht zu versteuern.
Beachten Sie | Die Kosten sind nicht nur auf die Mitarbeiter zu verteilen, die das Angebot tatsächlich in Anspruch genommen haben. Denn die Arbeitnehmer haben den Nutzungsvorteil, dass für sie jederzeit eine Trainingsmöglichkeit vorgehalten wird.
Berechnung der Verzugszinsen
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 2025 bis zum 31. Dezember 2025 beträgt 1,27 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 6,27 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 10,27 Prozent*
- für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 9,27 Prozent.
Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).
Übersicht / Basiszinssätze
| Zeitraum | Zinssatz |
|---|---|
| 01.01.2025 bis 30.06.2025 | 2,27 Prozent |
| 01.07.2024 bis 31.12.2024 | 3,37 Prozent |
| 01.01.2024 bis 30.06.2024 | 3,62 Prozent |
| 01.07.2023 bis 31.12.2023 | 3,12 Prozent |
| 01.01.2023 bis 30.06.2023 | 1,62 Prozent |
| 01.07.2022 bis 31.12.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2022 bis 30.06.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2021 bis 31.12.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2021 bis 30.06.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2020 bis 31.12.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2020 bis 30.06.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2019 bis 31.12.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2019 bis 30.06.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2018 bis 31.12.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2018 bis 30.06.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2017 bis 31.12.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2017 bis 30.06.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2016 bis 31.12.2016 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2016 bis 30.06.2016 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2015 bis 31.12.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.01.2015 bis 30.06.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2014 bis 31.12.2014 | -0,73 Prozent |
| 01.01.2014 bis 30.06.2014 | -0,63 Prozent |
| 01.07.2013 bis 31.12.2013 | -0,38 Prozent |
| 01.01.2013 bis 30.06.2013 | -0,13 Prozent |
| 01.07.2012 bis 31.12.2012 | 0,12 Prozent |
Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 11/2025
Im Monat November 2025 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten:
Steuertermine (Fälligkeit):
- Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): 10.11.2025
- Lohnsteuerzahler (Monatszahler): 10.11.2025
- Gewerbesteuerzahler: 17.11.2025
- Grundsteuerzahler: 17.11.2025
Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstermin vorliegen.
Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten Zahlung durch Überweisung endet 13.11.2025 für die Umsatz- und Lohnsteuerzahlung und am 20.11.2025 für die Gewerbe- und Grundsteuerzahlung. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt.
Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig, für den Beitragsmonat November 2025 am 26.11.2025.